
Weitere Angebote der PZ

© 2025 Avoxa - Mediengruppe Deutscher Apotheker GmbH
Angst vor Erbgutschäden durch Impfstoffe unbegründet |
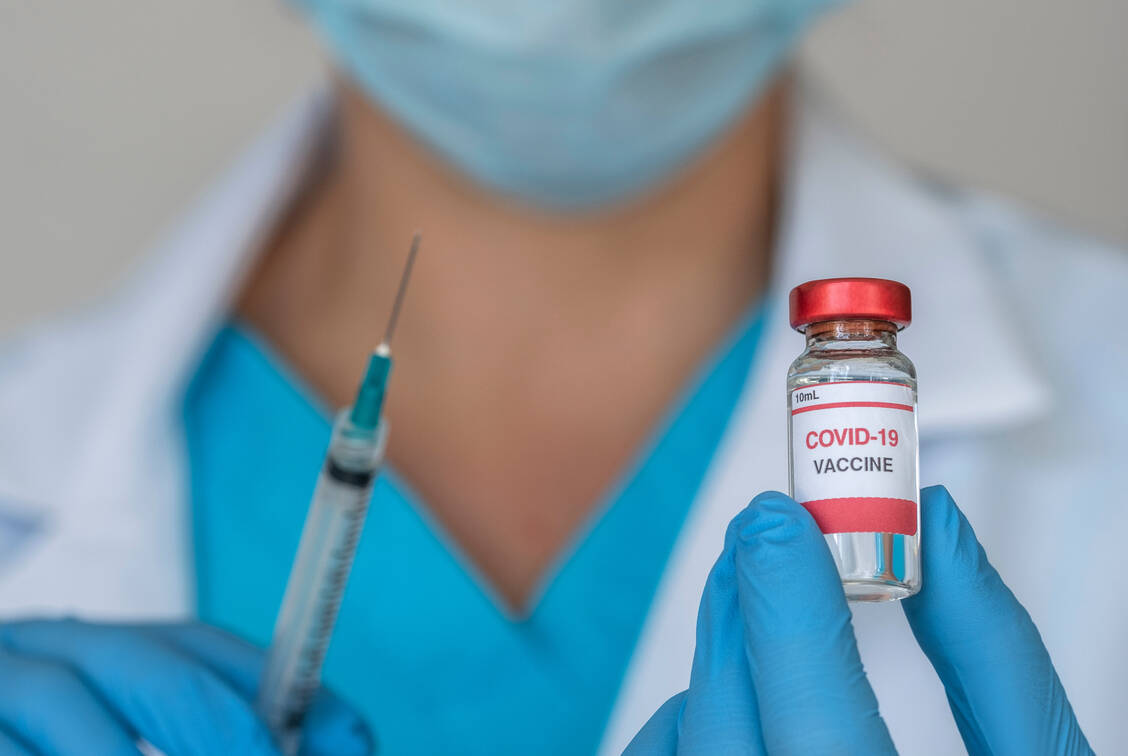
Erfahrungen mit mRNA-Impfstoffen beim Menschen gibt es schon, wenn auch in einem anderen Zusammenhang. Diese verliefen ohne besorgniserregende Nebenwirkungen. / Foto: Getty Images/Tetra Images
Auch Angaben von Impf-Skeptikern, es gebe noch keinerlei humanmedizinische Erfahrungswerte mit Gen-Impfstoffen, widersprach der PEI-Präsident in einem Gespräch mit der »Neuen Osnabrücker Zeitung« (Donnerstag). »Es gibt schon Erfahrungen mit mRNA-Impfstoffen beim Menschen im Rahmen klinischer Prüfungen, etwa mit einem therapeutischen Tumorimpfstoff. Dabei haben sich keine besorgniserregenden Nebenwirkungen gezeigt.
Auch bei umfangreichen Tierversuchen mit mRNA-Impfstoffen gab es keine Hinweise auf schwere Nebenwirkungen oder Schäden.« Um in die menschliche Erbinformation (DNA) eingebaut zu werden, müsste die RNA aus dem Impfstoff zudem »zurückgeschrieben« werden, so Cichutek. »Dazu wären zwei Enzyme notwendig, die normale menschliche Zellen nicht haben.«
Wie das PEI auf seiner Website erklärt, befindet sich das Genom beim Menschen in Form von DNA im Zellkern. RNA und DNA haben eine unterschiedliche chemische Struktur, weshalb eine Integration des einen in das andere laut PEI nicht möglich ist. Es gebe zudem keinen Hinweis, dass die von den Körperzellen nach der Impfung aufgenommenen mRNA ind DNA umgeschrieben würden.
Mehrere Impfstoffhersteller wollen in Kürze die Zulassung beantragen und berichten von einer Wirksamkeit ihrer Vakzine von 90 bis 94,5 Prozent. Schon aus den Prüfphasen I und II gebe es Daten, die sehr zuversichtlich machten, hieß es dazu beim PEI. Es sei davon auszugehen, dass sich dies in der laufenden Phase 3 mit Zehntausenden von Probanden bestätige. Für eine Zulassung in Europa ist das grüne Licht der EU-Kommission nötig.
Bei der Impfung mit einem RNA-Impfstoff wird eine genetische Information in einen Muskel injiziert und die RNA (Ribonukleinsäure) in einigen Körperzellen der geimpften Person aufgenommen. Diese genetische Information dient dem Bau eines ungefährlichen Bestandteils des Erregers. DieKörperzellen, die die RNA aufgenommen haben, nutzen deren genetische Information, um Erregerbestandteile zu produzieren. Diese sind nicht infektiös und lösen auch keine Erkrankung aus. Vielmehr erkennt das Immunsystem erkennt den fremden Erregerbestandteil als Antigen und betrachtet die Zellen, die diesen Erregerbestandteil gebaut haben, als vermeintlich infizierte Zellen. Das sorgt dafür, dass es gegen den Erreger und gegebenenfalls gegen mit dem Erreger infizierte Zellen eine schützende Immunantwort aufbaut, die im Falle einer Exposition die Infektion oder zumindest die Infektionskrankheit verhindern oder ihren Verlauf abmildern soll.
Quelle: PEI
Coronaviren lösten bereits 2002 eine Pandemie aus: SARS. Ende 2019 ist in der ostchinesischen Millionenstadt Wuhan eine weitere Variante aufgetreten: SARS-CoV-2, der Auslöser der neuen Lungenerkrankung Covid-19. Eine Übersicht über unsere Berichterstattung finden Sie auf der Themenseite Coronaviren.