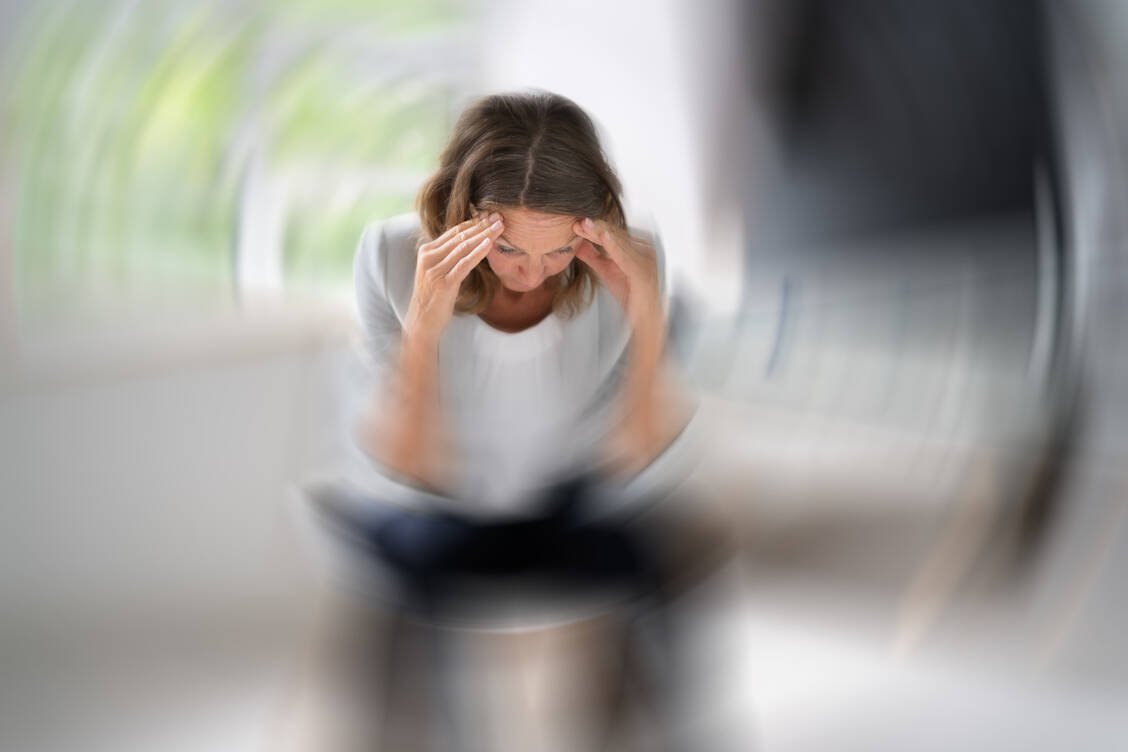Bei Liftschwindel fühlt man sich, als führe man in einem Fahrstuhl auf und ab. Die möglichen Folgen: Benommenheit, unsicherer Gang, aber auch Übelkeit, Erbrechen, Fallneigung, Augenzittern, Hör- und Sehstörungen, Kopfschmerzen und andere neurologische Ausfallerscheinungen. Ursachen können Probleme des Innenohrs bei der Verarbeitung von Sinnesreizen im Gehirn sein – etwa nach Schlaganfällen, bei chronischen Entzündungen im Gehirn oder verschiedenen neurologischen Erkrankungen – sowie starke Blutdruckschwankungen oder auch eine Herzschwäche. Bei einigen Formen wird allerdings keine organischen Ursachen gefunden.