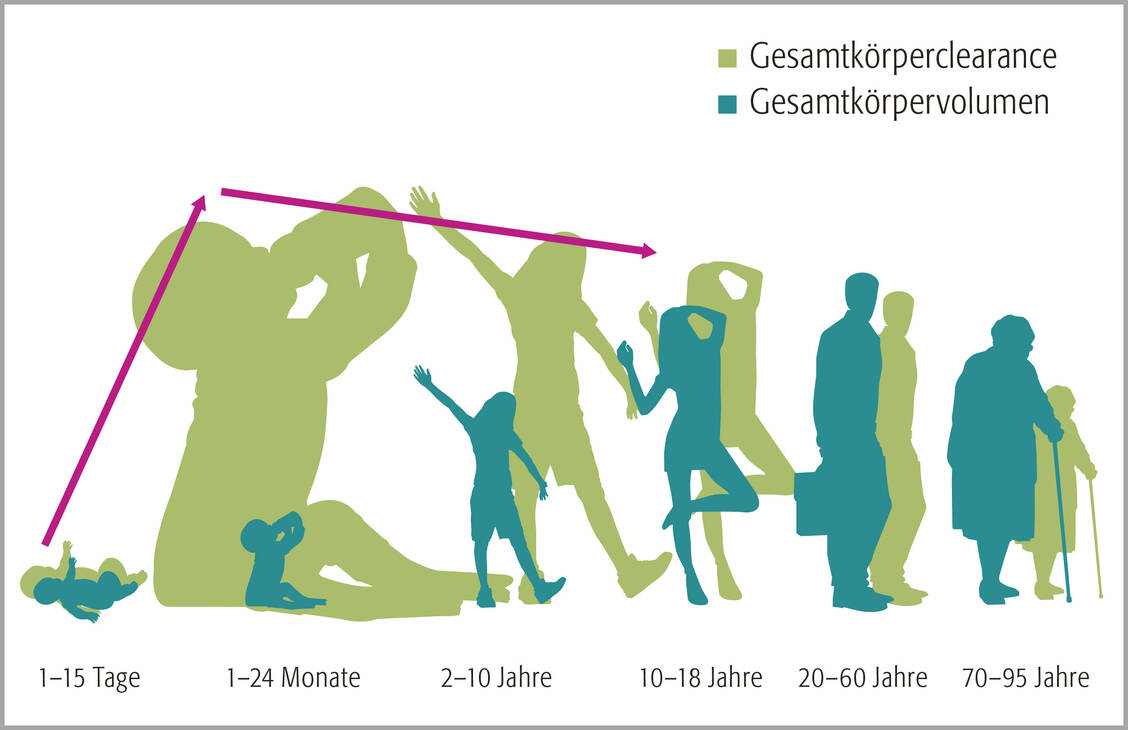Ein Paradebeispiel für Arzneimittel, die in der Handhabung Schwierigkeiten bereiten, sind Antibiotika-Trockensäfte. Eine exakte Dosierung setzt zum einen die richtige Zubereitung voraus, weshalb der Saft am besten in der Apotheke hergestellt werden sollte. Zum anderen bergen die unterschiedlichen Schaumbildungen und Sedimentationsgeschwindigkeiten der einzelnen Trockensäfte beim Aufschütteln vor der Anwendung zu Hause weitere Fallstricke in Sachen präziser Dosierung. Mit dem Hinweis »Einnahme spätestens drei Minuten nach dem Schütteln« ist die PTA auf der sicheren Seite.
Dr. Wolfgang Kircher will es genauer wissen und versah seine Amoxicillin-Clavulansäure-Trockensäfte in seinem Tüftel-Apothekenlabor mit einem digitalen Modul. Diese besitzen Sensoren, die Daten für Temperatur der Flasche bei Aufbewahrung, im Kühlschrank und Entnahme, Beschleunigung der Flasche durch Umschütteln und Flaschenneigung erstellen. Diese kontinuierlich erhobenen Daten werden dann an den PC in der Apotheke übertragen und geben dem Apotheker Rückmeldung über die korrekte Anwendung. Ein gutes Beispiel dafür, dass digital vernetzte Arzneiformen die Arzneimitteltherapie etwa bei Kindern sicherer machen können.