
Weitere Angebote der PZ

© 2025 Avoxa - Mediengruppe Deutscher Apotheker GmbH
Auf der Suche nach Covid-19-Medikamenten |
 |  | Sven Siebenand |
 |
14.12.2020 12:30 Uhr |
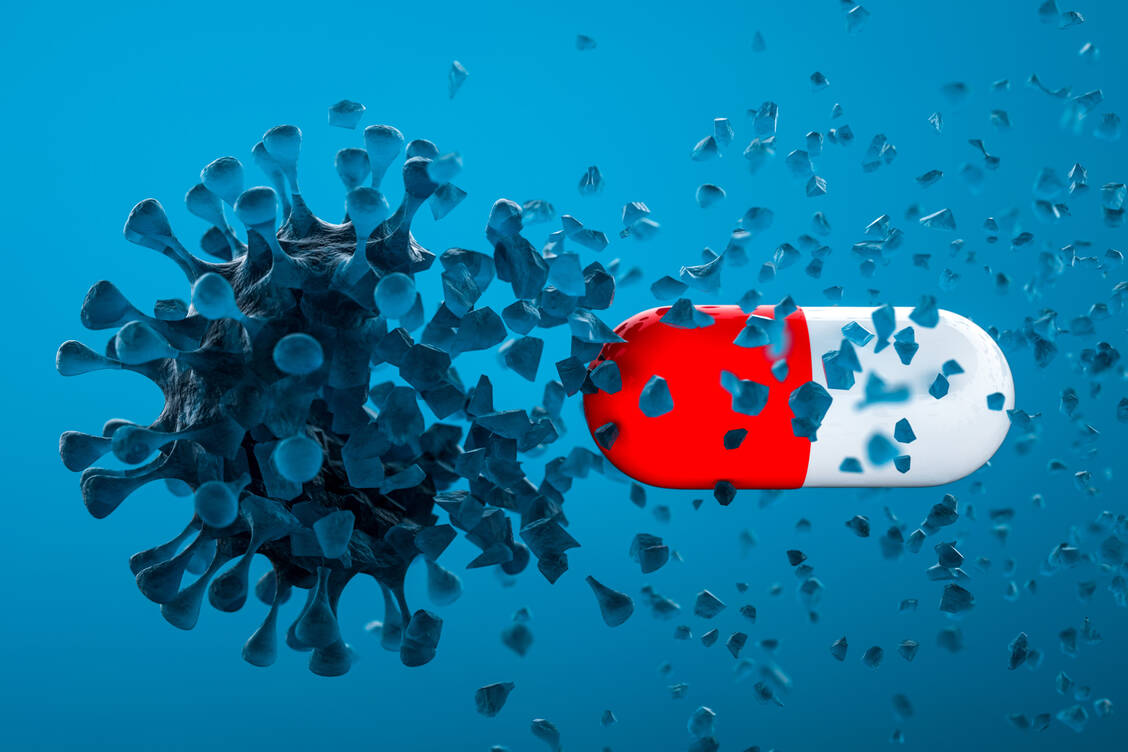
Neben der Forschung an einer Impfung suchen Wissenschaftler weltweit nach Arzneistoffen, um Covid-19 auch medikamentös beherrschen zu können. / Foto: Getty Images/dowell
Einzelne Wirkstoffe wurden bereits für den Einsatz bei Covid-19-Patienten zugelassen. Besonders viel Aufmerksamkeit erfuhr das antiviral wirksame Remdesivir (Veklury®). Im Körper wird der Arzneistoff in die aktive Form überführt. Diese hemmt das Enzym RNA-abhängige Polymerase. Das Medikament wirkt somit antiviral. Veklury wird infundiert. Als Standard kristallisiert sich die Fünf-Tage-Therapie heraus. Die neueste Leitlinie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von Ende November empfiehlt Remdesivir nicht mehr für Patienten, die mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert werden, unabhängig davon, wie schwer sie erkrankt sind. Es gebe derzeit keine Hinweise darauf, dass Remdesivir das Überleben oder die Notwendigkeit einer Beatmung verbessere. Die Europäische Arzneimittelagentur hat angekündigt, die Daten selbst neu zu bewerten. Mit Spannung darf man zum Beispiel auf die kompletten Ergebnisse der sogenannten Solidarity -Studie warten
Auch die aktive Form von Favipiravir hemmt die RNA-abhängige Polymerase von Viren, ist aber wie Remdesivir nicht spezifisch für SARS-CoV-2. Favipiravir ist seit einigen Jahren in Japan auf dem Markt – als Reservearzneistoff gegen die Influenza. Nachdem der Arzneistoff in einer Studie Krankheitsdauer und Symptomlast bei Covid-19-Kranken reduzieren konnte, wird in Japan eine Indikationserweiterung für das Favipiravir-haltige Medikament Avigan® angestrebt. Diese Zulassung hat der Wirkstoff in Russland bereits erhalten: Das Präparat heißt Avifavir®. Favipiravir ist im Gegensatz zu Remdesivir oral bioverfügbar.
Der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA empfiehlt mittlerweile den Einsatz von Dexamethason bei beatmeten Covid-19-Patienten. Für Patienten ohne zusätzlichen Sauerstoffbedarf oder Beatmung gilt diese Empfehlung ausdrücklich nicht. Dass es sich um einen Gruppeneffekt der Glucocorticoide handelt, ist wahrscheinlich. Auch mit anderen Corticoiden wurden positive Ergebnisse bei schwerkranken Covid-19-Patienten erzielt.
Ferner ist in den Kliniken schon seit längerer Zeit bekannt, dass thromboembolische Ereignisse eine häufige Komplikation bei Covid-19 sind und dass Antikoagulanzien, etwa Heparine, Leben retten können. Konkrete Zulassungserweiterungen wurden noch nicht ausgesprochen. Das eine oder andere Antikoagulans, so auch neue orale Antikoagulanzien (NOAK) wie Edoxaban (Lixiana®) und Rivaroxaban (Xarelto®) und das niedermolekulare Heparin Enoxaparin werden getestet.
Auffallend viele aus anderen Einsatzgebieten bekannte Wirkstoffe werden in Studien bei Covid-19 mittlerweile untersucht. Das sogenannte Repurposing ist auch sinnvoll. Denn bereits zugelassene Substanzen haben Studien durchlaufen und ihr Sicherheitsprofil ist meist besser bekannt als jenes von Substanzen in der klinischen Testung oder aus der Präklinik. Unter den derzeitigen Testsubstanzen finden sich aber dennoch Kandidaten, die noch in keiner Indikation zugelassen sind und teilweise aus der präklinischen Entwicklung stammen.
Wenig überraschend sollen eine Menge der Testkandidaten antiviral wirken. Solange es keine SARS-CoV-2-spezifischen Wirkstoffe – an denen gearbeitet wird – gibt, ist es nur folgerichtig, antivirale Substanzen aus anderen Einsatzgebieten zu untersuchen, beispielsweise HIV-, Hepatitis- oder Influenza-Medikamente. So werden verschiedene HIV-Wirkstoffe auf ihre Wirksamkeit gegen SARS-CoV-2 untersucht. Dies ist beispielsweise bei dem Proteasehemmer Darunavir der Fall. Er wird in Kombination mit dem Booster Cobicistat in einer Phase-III-Studie bei Covid-19 getestet. Zu den Reverse-Transkriptase-Hemmern zählen Emtricitabin und Tenofovir, die in dem bekannten HIV-Medikament Truvada® enthalten sind. Auch damit gibt es eine Covid-19-Studie der Phase III.
Im Bereich Grippemittel, die gegen SARS-CoV-2 klinisch geprüft werden, ist neben dem bereits genannten Favipiravir zum Beispiel Umifenovir zu nennen. In Russland ist das Umifenovir-haltige Medikament Arbidol® als Grippemittel sehr bekannt. Umifenovir ist ein Fusionsinhibitor, der die Verschmelzung der Virushülle mit der Membran der Wirtszelle verhindern soll. Da auch SARS-CoV-2 ein umhülltes Virus ist, könnte Umifenovir also einen Nutzen haben. Auch das hierzulande sehr bekannte Oseltamivir-haltige Medikament Tamiflu® wird erprobt.
Auch das Wirkprinzip von APN01 ist interessant. SARS-CoV-2 nutzt das Protein Angiotensin-Converting-Enzym (ACE2) als Corezeptor auf der Oberfläche menschlicher Zellen, um in diese einzutreten. APN01 gaukelt dem Virus vor, es sei die Eintrittspforte zur Zelle. Statt an den Corezeptor auf der Zelloberfläche zu binden, docken die Viren an den Arzneistoffkandidaten – ein rekombinantes humanes ACE2 – an.
Wiederum ein anderes Target weisen zwei weitere Kandidaten auf: Sowohl Nafamostat als auch Camostat hemmen das Enzym transmembranäre Serinprotease 2. SARS-CoV-2 benötigt dieses im menschlichen Körper vorhandene Enzym, um in die Zelle einzudringen. Beide Arzneistoffe sind schon seit vielen Jahren, vor allem in Asien, bekannt.
Auch hierzulande sehr gut bekannt sind Famotidin und Ivermectin. In Megadosen als Infusion verabreicht wurde das Magenmittel Famotidin vor einigen Monaten als Covid-19-Medikament ins Spiel gebracht. Es soll mit hoher Wahrscheinlichkeit an das virale Enzym Papain-ähnliche Protease binden und so die Virusvermehrung hemmen. Beim Antiparasitikum Ivermectin wird vermutet, dass es den Import von Virusproteinen in den Zellkern blockiert und dass dieser Mechanismus auch bei SARS-CoV-2 zum Tragen kommt.
Bei den Covid-19-Studien sind mehrere zu finden, die ein Interferon unter die Lupe nehmen. Interferone sind wichtige Botenstoffe, die selbst nicht antiviral wirksam sind, aber die Produktion von antiviral wirksamen Proteinen induzieren. Sie helfen dem Immunsystem somit, Erreger zu erkennen und zu eliminieren. Getestet werden zum Beispiel verschiedene Alpha- und Beta-Interferone.
Als Autophagie bezeichnet man den Prozess, den Zellen nutzen, um beschädigtes Material und Abfallprodukte abzubauen. Auch Bestandteile von Krankheitserregern wie Viren werden als Abfallprodukte erkannt und entsorgt. SARS-CoV-2 gelingt es offenbar, diese Mechanismen zu torpedieren. Mithilfe von Autophagie-Boostern wie dem Bandwurmmittel Niclosamid oder Spermidin will man dies rückgängig machen.
Neben antiviral wirksamen Mitteln sind unter den Testsubtanzen auch viele Immunmodulatoren zu finden. Sie werden mit dem Ziel erprobt, einen gefährlichen Zytokinsturm, die Überreaktion des Immunsystems, bei Covid-19-Patienten zu verhindern. Sehr viele Studien mit Antikörpern laufen bereits. Dabei sind einige, die in das Komplementsystem, einen wichtigen Teil der unspezifischen humoralen Immunabwehr, eingreifen. Die Antikörper Eculizumab (Soliris®), Ravulizumab (Ultomiris®) und IFX-1 richten sich zum Beispiel gegen den Komplementfaktor C5a.
Forscher halten auch Interleukin-6 (IL-6) für ein gutes Target, um den Zytokinsturm bei Covid-19 zu beherrschen. IL-6-Antikörper sind zur Behandlung anderer Erkrankungen schon lange auf dem Markt. Tocilizumab (Roactemra®), Sarilumab (Kevzara®) und Siltuximab (Sylvant®) werden in vielen Studien nun auch bei Covid-19 untersucht. Manche Ergebnisse waren enttäuschend, teilweise gibt es aber auch Hoffnungsschimmer zu vermelden. In Russland ist der Antikörper Levilimab (Ilsira®), der sich gegen den IL-6-Rezeptor richtet, bereits registriert für die Behandlung von schwerkranken Covid-19-Patienten.
Nicht nur mit Antikörpern ist es möglich, immunmodulatorische Effekte zu erzielen. Die Vertreter der Klasse der Januskinase-Hemmer zum Beispiel wirken auch immunmodulatorisch. Daher wundert es wenig, dass auch sie klinisch erprobt werden. Zu den JAK-Hemmern zählen unter anderem Baricitinib (Olumiant®), Tofacitinib (Xeljanz®) und Ruxolitinib (Jakavi®).
Im Gespräch ist auch die Immunmodulation via Toll-like-Rezeptoren (TLR). TLR sind wichtige Strukturen des angeborenen Immunsystems. Sie erkennen zum Beispiel Bestandteile von Viren und Bakterien und können so biochemische Reaktionsketten in Gang setzen, die der Abwehr dieser Krankheitserreger dienen. Doch Achtung: Eine übermäßige Aktivierung von TLR7/8 kann aber zu einer übermäßigen Mobilisierung von Immunzellen und einem Entzündungsgeschehen führen, das bei unzureichender Regulierung schwere Störungen des Immunsystems zur Konsequenz haben kann.
M5049 wird für verschiedene immunologische Indikationen entwickelt und unter anderem auch bei Covid-19 getestet. Es soll die Aktivierung der TLR 7 und 8 blockieren. Möglicherweise könnte aber auch eine agonistische Aktivität an TLR einen Nutzen haben. Ein Nasenspray mit der Substanz INNA-051 befindet sich in der Pipeline. Es wirkt als Agonisten an TLR2/6 und soll das angeborene Immunsystem besonders rasch und früh aktivieren, sodass das Spray zur Prophylaxe eingesetzt werden könnte.
Aufgrund seiner immunmodulatorischen Eigenschaften ist auch der alt bekannte Wirkstoff Colchicin ein mögliches Covid-19-Mittel. Das vor allem als Gichtmedikament bekannte Alkaloid der Herbstzeitlosen wird gleich in mehreren Studien erprobt. Ebenso bekannt wie Colchicin sind Alphablocker wie Prazosin. Man geht davon aus, dass Catecholamine die Freisetzung von Zytokinen triggern können und damit einen negativen Einfluss auf die Entwicklung der Immunreaktion ausüben. Aus diesem Grund hofft man, einen Zytokinsturm bei Covid-19 mithilfe eines Alphablockers verhindern zu können.
Schnell nach Ausbruch der Coronavirus-Pandemie kam die Idee der Passivimmunisierung mit Antikörpern aus dem Blut von Personen auf, die die SARS-CoV-2-Infektion (oder andere Coronavirus-Infektionen wie SARS und MERS) bereits durchgemacht haben. Dabei erhalten die Patienten eine Blutplasmaspende als Infusion. Andere Unternehmen gewinnen aus einer Plasmaspende zunächst die Antikörper und stellen danach ein Hyperimmunglobulin zur Infusion her.
Eine Weiterentwicklung dieses Verfahrens ist es, geeignete Antikörper auszuwählen und diese dann biotechnologisch in großem Maßstab in Zellkulturen herzustellen. Auch der experimentelle Antikörper-Cocktail, den Donald Trump nach seiner Covid-19-Erkrankung im Rahmen eines Härtefallprogramms erhalten hat, ist hier einzuordnen. Das Prüfpräparat REGN-COV2 ist eine Kombination aus zwei Antikörpern, REGN10933 und REGN10987. Sie binden nicht-kompetitiv an die Rezeptorbindungsdomäne des Spike-Proteins von SARS-CoV-2.
Forscher erhoffen sich ferner von künstlich hergestellten Antikörpern beziehungsweise Antikörpern tierischen Ursprung einen Nutzen. Beispielsweise wird schon seit längerer Zeit an speziellen Antikörpern von Lamas geforscht, die möglicherweise eine »tierische Hilfe« gegen SARS-CoV-2 darstellen könnten.
Wenig überraschend finden sich unter den Arzneistoffkandidaten zur Behandlung von Covid-19 auch einige Medikamente, die für die Therapie von Lungenerkrankungen entwickelt wurden und werden. Ein Beispiel dafür ist Ifenprodil. Das Medikament wirkt als Inhibitor am NMDA-Rezeptor. Daraus leitete man zunächst einen Nutzen bei neurologischen Erkrankungen ab. Seit einiger Zeit wird es bei idiopathischer Lungenfibrose entwickelt und nun auch klinisch bei Covid-19-Patienten getestet.
Ein anderes Beispiel ist das synthetische Peptid Solnatide, das in einem Härtefallprogramm bei Covid-19-Patienten in Österreich bereits eingesetzt werden darf. Genauer gesagt: zur Behandlung von SARS-CoV-2-induzierter akuter Lungenfunktionsstörung bei mechanisch beatmeten Covid-19-Patienten. Solnatide wird direkt in Form eines flüssigen Aerosols in die unteren Atemwege eingebracht. Es soll Ausmaß von alveolären Ödemen reduzieren und deren Auflösung beschleunigen.
Lunge zum Dritten: Seit Jahren ist bekannt, dass die inhalative Gabe von Stickstoffmonoxid (NO) das Überleben beim akuten Lungenversagen verbessern kann. Das Gas soll in der Lunge als Vasodilatator wirken und damit die Muskelzellen der Lungengefäße relaxieren.
Dass es gelingt, gut wirksame - und auch sichere - Covid-19-Medikamente zu entwickeln, ist sehr wahrscheinlich. Wann das sein wird, kann niemand genau sagen. Ein ganz schnelles Allheilmittel wird es leider nicht geben. Sehr erfreulich ist aber, dass sich viele Firmen zusammen an die Arbeit gemacht haben und die Forscher weltweit kooperieren. Das verkürzt sicher die Dauer der Entwicklung.
Coronaviren lösten bereits 2002 eine Pandemie aus: SARS. Ende 2019 ist in der ostchinesischen Millionenstadt Wuhan eine weitere Variante aufgetreten: SARS-CoV-2, der Auslöser der neuen Lungenerkrankung Covid-19. Eine Übersicht über unsere Berichterstattung finden Sie auf der Themenseite Coronaviren.