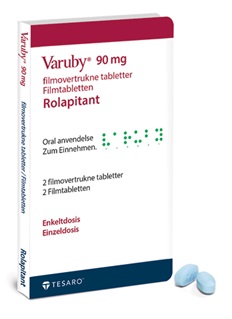Weiterer Neurokinin-1-Rezeptor-Antagonist
Für Chemotherapie-Patienten, die unter Erbrechen oder Übelkeit leiden, steht ab Juni eine neue langwirksame Therapieoption zur Verfügung: Rolapitant (Varuby® 90 mg Filmtabletten, Tesaro).
Der Wirkstoff kann zur Prävention von verzögert auftretender Übelkeit und Erbrechen im Zusammenhang mit einer hoch oder mäßig emetogenen Chemotherapie bei Erwachsenen eingesetzt werden. Dabei soll er mit Dexamethason und einem 5-HT3-Rezeptorantagonisten kombiniert werden. Wie die bereits auf dem Markt verfügbaren Wirkstoffe Aprepitant, Fosaprepitant und Netupitant wirkt er als selektiver und kompetitiver Antagonist am Neurokinin-1-Rezeptor. Damit verhindert er, dass die Übelkeit und Erbrechen verursachende Substanz P an diese Rezeptoren bindet. Rolapitant zeichnet sich durch eine lange Halbwertzeit von sieben Tagen aus.
Laut Fachinformation werden 180 mg Rolapitant innerhalb von zwei Stunden vor Beginn jedes Chemotherapiezyklus gegeben, jedoch nicht häufiger als in einem Abstand von mindestens zwei Wochen. Die Einnahme kann unabhängig von einer Mahlzeit erfolgen. Ab einem Alter von 75 Jahren sollte der neue Wirkstoff nur mit Vorsicht eingesetzt werden. Gleiches gilt bei schwer beeinträchtigter Nieren- oder Leberfunktion.
Rolapitant hemmt das Leberenzym CYP2D6. Daher sollte der Arzt Vorsicht walten lassen, wenn es um eine Kombination mit Arzneimitteln geht, die ebenfalls auf diesem Weg verstoffwechselt werden. Weitere Interaktionen mit Substraten des P-Glykoproteins (P-gp) wie Digoxin oder des Breast-Cancer-Resistance-Proteins (BCRP) wie Methotrexat, Irinotecan, Rosuvastatin, Sulfasalazin oder Doxorubicin sind möglich, da Rolapitant BCRP und P-gp hemmt.
Andere Arzneimittel können sich wiederum auf die Pharmakokinetik von Varuby auswirken. Deshalb eignet sich Rolapitant nicht bei Patienten, die dauerhaft starke oder moderate Enzyminduktoren bekommen, wie zum Beispiel Rifampicin, Carbamazepin, Phenobarbital, Enzalutamid, Phenytoin sowie Efavirenz oder Rifabutin. Die Kombination mit Johanniskraut ist aus diesem Grund sogar kontraindiziert.
Wenn nicht unbedingt erforderlich, sollten Schwangere kein Rolapitant erhalten. Auch das Stillen wird unter diesem Pharmakon nicht empfohlen. Häufig berichten Patienten unter Varuby-Therapie über Ermüdung, Kopfschmerz und Verstopfung.