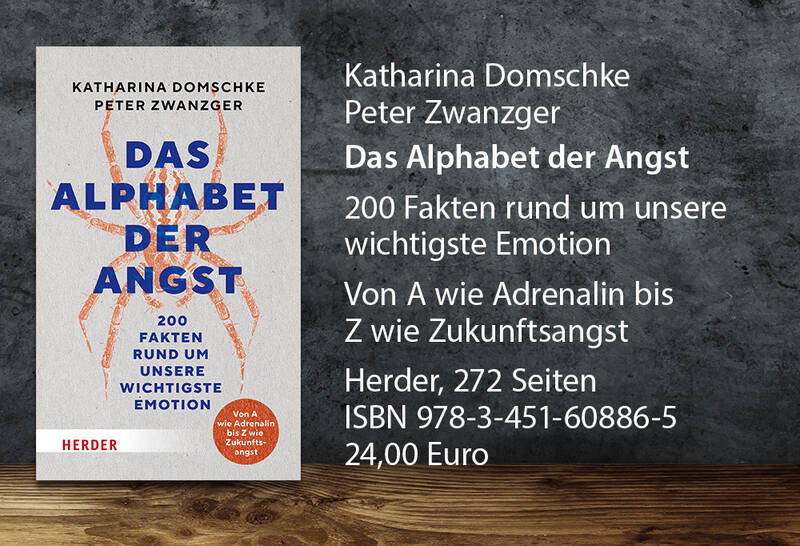Dass mehr Frauen Angst vor Spinnen haben als Männer, könnte daran liegen, dass sich Jungen angesichts gesellschaftlicher Rollenklischees schon als kleine Kinder schwerer tun, den Kontakt zu Spinnen zu vermeiden, als Mädchen. Eine frühe, eher spielerische Konfrontation könnte dazu beitragen, dass Phobien gar nicht erst entstehen. Untersuchungen mit Unterrichtsmodellen in Grundschulen, die sich gezielt und positiv mit Spinnen auseinandersetzen, stützen solche Überlegungen. Angst und Ekel könnten so sogar in Interesse und Sympathie umschlagen. Wer seine Kinder vor einer Spinnenphobie bewahren möchte, kann mit ihnen die Achtbeiner demnach in Bilderbüchern, Filmen oder auf Fotos betrachten oder idealerweise auf die Pirsch gehen, um sie in freier Natur aus der Nähe zu beobachten.