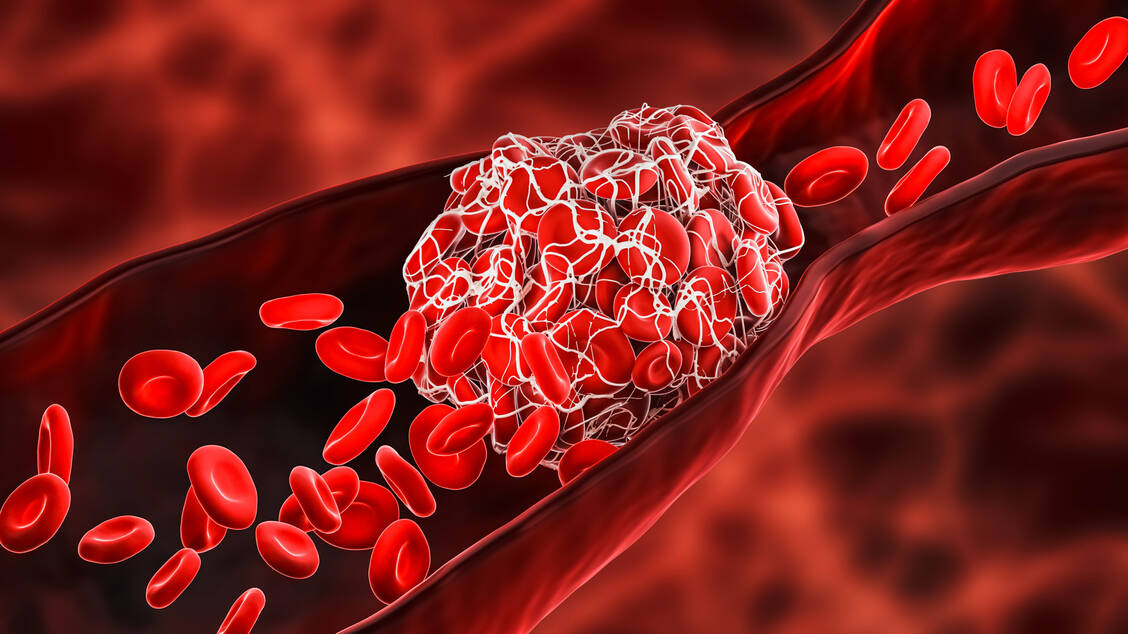Kardiologen sind heute in der Lage, den Schaden, den ein Herzinfarkt am Herz erzeugt, zu minimieren oder im Idealfall ganz zu verhindern, wenn Patienten schnell behandelt werden. Die Therapie beginnt deshalb bereits im Rettungswagen mit Acetylsalicylsäure und Heparin. Das angesteuerte Krankenhaus wird verständigt, sodass beim Eintreffen direkt mit der Behandlung im Herzkatheterlabor begonnen werden kann. Unter lokaler Betäubung wird nun über eine Arterie am Handgelenk oder der Leiste ein Katheter bis zum Herz vorgeschoben und die Herzkranzgefäße untersucht. Ist die verengte Stelle gefunden, wird ein Ballon aufgeblasen, der die Verengung erweitert. Um das Gefäß dauerhaft offen zu halten, wird ein Stent eingesetzt. Bei Menschen mit schwerer KHK oder gleichzeitig bestehendem Diabetes kann ebenso wie bei Betroffenen, bei denen mehrere Blutgefäße verschlossen sind, eine Bypass-Operation, bei der das verengte Gefäß operativ überbrückt wird, in Erwägung gezogen werden.