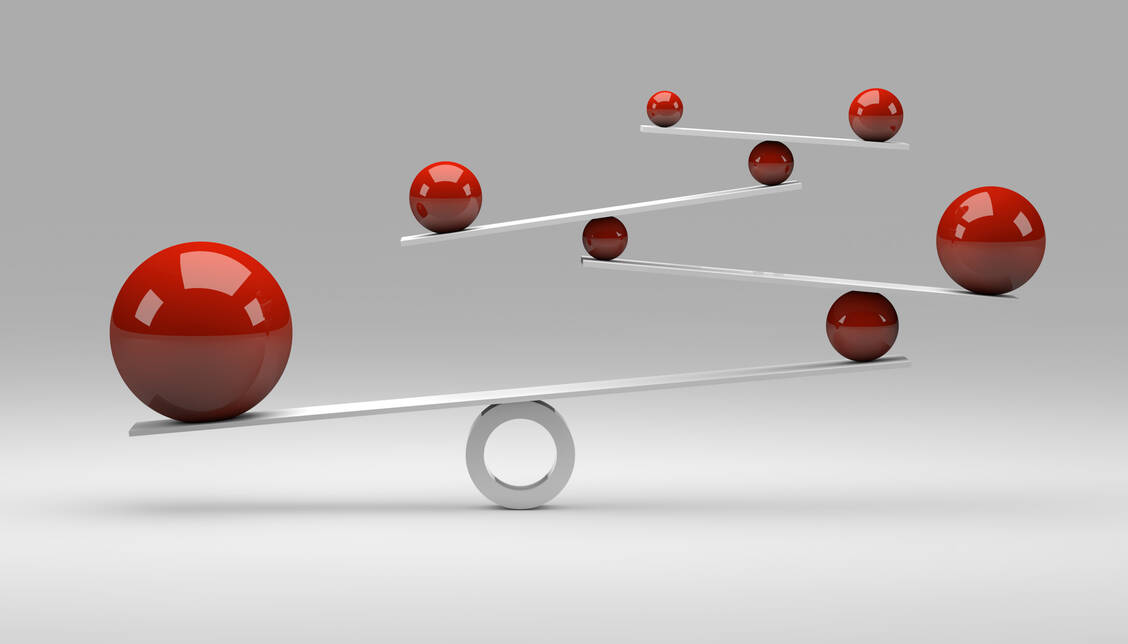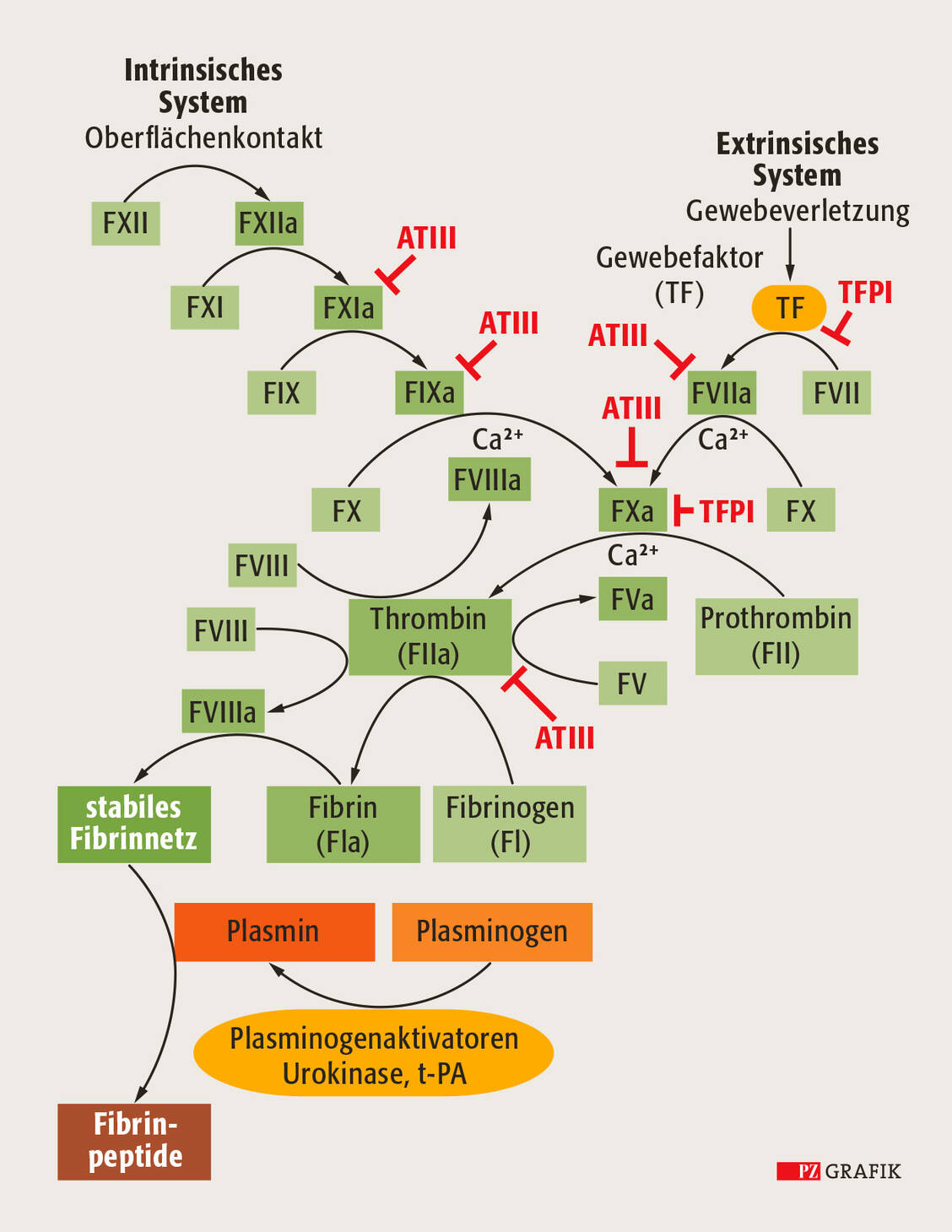Viele Patienten kämpfen, wenn sie sich erstmals selbst piksen sollen. Doch die Anwendung ist überraschend leicht – man muss sich also »nur« trauen! Üblicherweise werden niedermolekulare Heparine subkutan in das Fettgewebe seitlich am Bauch oder Oberschenkel gespritzt.
Und so geht’s: Patienten setzen oder legen sich am besten bequem so hin, dass sie die Injektionsstelle sehen. Zur Vorbereitung reinigen sie die Haut etwa mit einem Alkoholtupfer. Liegen diese dem Fertigarzneimittel nicht bei, freuen sich Kunden über diese Zugabe. Wenn die Spritzenlösung klar und ohne Schwebstoffe aussieht, können Patienten die Schutzkappe abnehmen. Ist eine Luftblase in der Spritze? Keine Sorge, das muss sein! Sie dient dazu, den Arzneistoff vollständig zu entleeren. Hängt ein Tropfen an der Nadelspitze? Der wird am besten sanft abgeschüttelt. Denn Wirkstoff im Stichkanal brennt und kann einen unnötig großen Bluterguss an der Einstichstelle hervorrufen. Doch selbst bei perfekter Technik lassen sich diese leider nicht ganz vermeiden.
Dann mit der nicht dominanten Hand eine Hautfalte zwischen Zeigefinger und Daumen bilden, die Spritze wie einen Stift in die andere Hand nehmen, tief durchatmen und beherzt (!) senkrecht im 90°-Winkel in die Hautfalte stechen. Aus Angst stechen viele nur zögerlich zu. Doch je rascher, desto weniger zwickt es. Dann langsam den Kolben herunterdrücken, bis fünf zählen, die Nadel rausziehen und erst jetzt die Hautfalte lösen. Geschafft! Verfügt die Spritze über einen automatischen Nadelschutz, löst sie aus, wenn die komplette Dosis appliziert wurde. Patienten sollten die Seite abwechseln und mindestens fünf Zentimeter Abstand zum Bauchnabel einhalten.