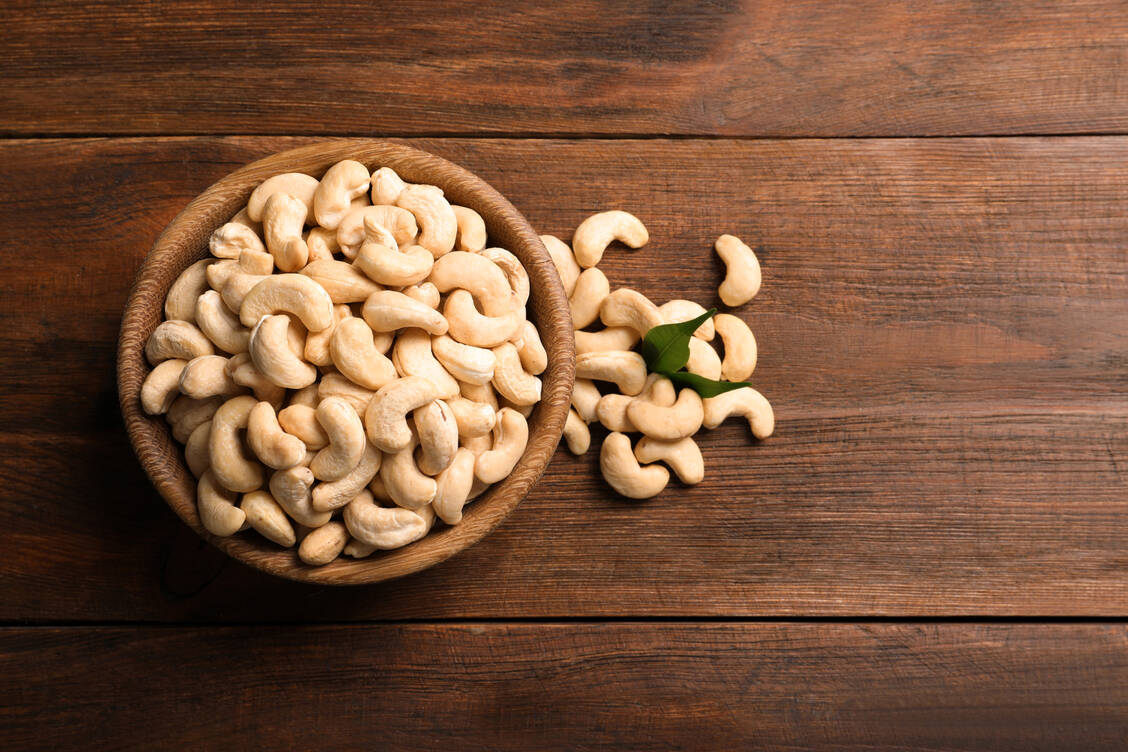Sind die Cashewkerne reif, fallen sie zu Boden. Etwa zwei Wochen später folgen ihre apfelartigen Fruchtstiele. Nach dem Aufsammeln müssen die Kerne vor der Weiterverarbeitung trocknen. In der Regel werden sie dazu geröstet, um leichter an das Innere zu gelangen. Auch heute wird die zwei bis drei Millimeter dicke harte Schale häufig noch in Handarbeit aufgebrochen. Denn der weiche, elfenbeinfarbene Kern ist empfindlich und für intakte, nicht gebrochene Ware sind höhere Preise zu erzielen. Sogenannter Cashewbruch ist daher deutlich günstiger im Handel. Doch nicht nur die holzige Hülle erschwert die Verarbeitung. Unter der Schale beziehungsweise in den Harzgängen zwischen Cashewfrucht und Schale befindet sich ein ätzendes Öl. Daher steht vor dem nächsten Schritt ein Röstvorgang an oder eine Behandlung über Wasserdampf, um das Öl zu entfernen. Beim Rösten entsteht jedoch ein schleimhautreizender Rauch. Für die Arbeiter ist es deshalb von Bedeutung, dass das Öl durch Bedampfen unschädlich gemacht wird. Mittels dieser Dampfdestillation kann das Öl gleichzeitig aufgefangen und genutzt werden. Die hautätzende Flüssigkeit ist reich an Phenolen und wird zur Herstellung von Bremsbelägen, für Schmiermittel, Gummi oder Farben eingesetzt. Welches Verfahren angewendet wird, erfahren die Käufer der kostbaren Ware allerdings in der Regel nicht.