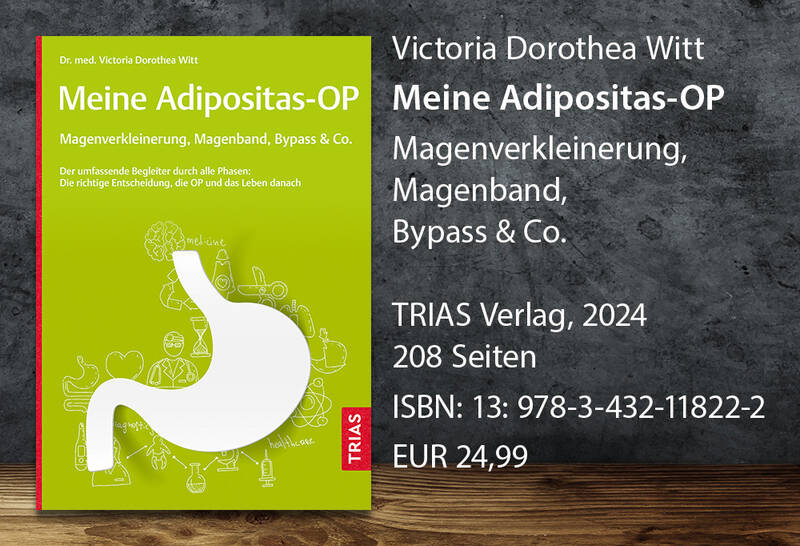Ein weiterer Grund, weshalb für Witt das Leben nach einer Adipositas-OP »nicht unbedingt einfach wie gewohnt weitergeht«, sind »Kopf und Seele«. Die Suche nach der eigenen Identität kann aufkommen: Wer bin ich ohne Übergewicht? Wie verbringe ich nun meine Zeit, da ich viel aktiver sein kann? Ängste um einen Rückfall in alte Muster können entstehen und die Frage, wie gehe ich mit meinem Umfeld um, das nun vielleicht anders auf mich reagiert, weil ich schlanker bin, mein Wesen aber doch dasselbe geblieben ist? Das führt Witt zum Punkt Stigmatisierung, für deren Überwindung sie sich einsetzt: Das können zum Beispiel Aussagen sein wie »Wenn du einfach weniger essen und dich mehr bewegen würdest, wärst du nicht so dick« bis »Ach so, du hast nur wegen einer Magenoperation abgenommen«.