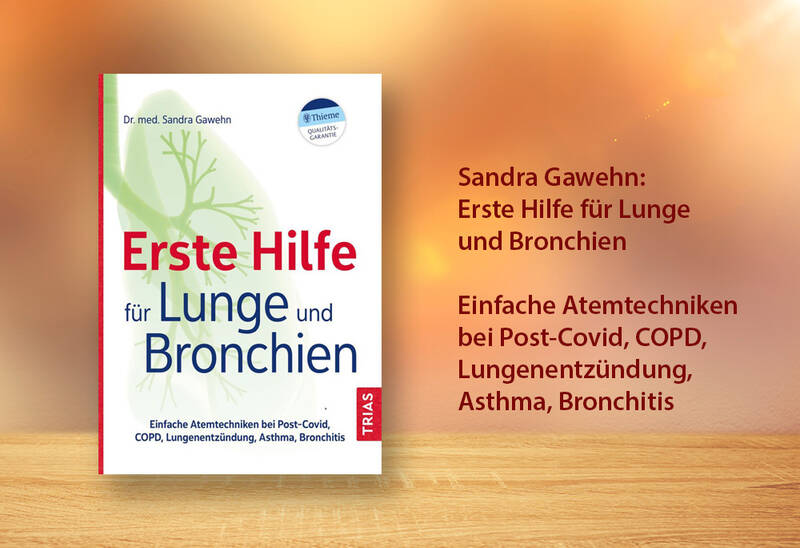Ältere Menschen können durch ein Training der Atemmuskulatur einigen Alterserscheinungen entgegenwirken. Senioren haben oft einen abgeschwächten Hustenstoß. Dieses Phänomen ist keine Lungenschwäche, sondern geht meistens darauf zurück, dass bei ihnen der große Rückenmuskel, der zugleich der größte Hustenmuskel ist, an Kraft verloren hat. Um ihn zu stärken, werden Bauch, Rücken und Rumpf trainiert. Dazu sind nicht gleich sportliche Höchstleistungen erforderlich.
Eine einfache und für fast jeden umsetzbare Übung ist das Singen. Wer mindestens drei Mal täglich singt, pfeift oder auch nur kräftig lacht, stärkt bereits seine Atemmuskultur. Wer sich etwas mehr bewegen möchte, kann es mit Schulterkreisen und Armkreisen versuchen. Beim »Ententanz-Lied« führen die Tänzer – bei Bedarf auch im Sitzen – Flügelschlagbewegungen durch und verbessern dadurch die Bewegungsfreiheit im Rumpfbereich.
Mobilere Menschen können ihr Training während eines Spaziergangs durchführen. Sie machen sich dazu einen Zählrhythmus zur Gewohnheit und atmen zum Beispiel drei Schritte lang ein und vier Schritte aus. Die Zählwerte werden so verteilt, dass die Ausatmung länger als die Einatmung dauert. Eingeatmet wird durch die Nase, den Mund halten Patienten geschlossen. Wer es noch sportlicher haben möchte, kann Hampelmannsprünge machen. Im Wasser stärken Aqua-Jogging und Aqua-Yoga die Atemmuskultur und tun besonders Asthmatikern gut, da die feuchte Luft ihre Atemwege nicht austrocknet.