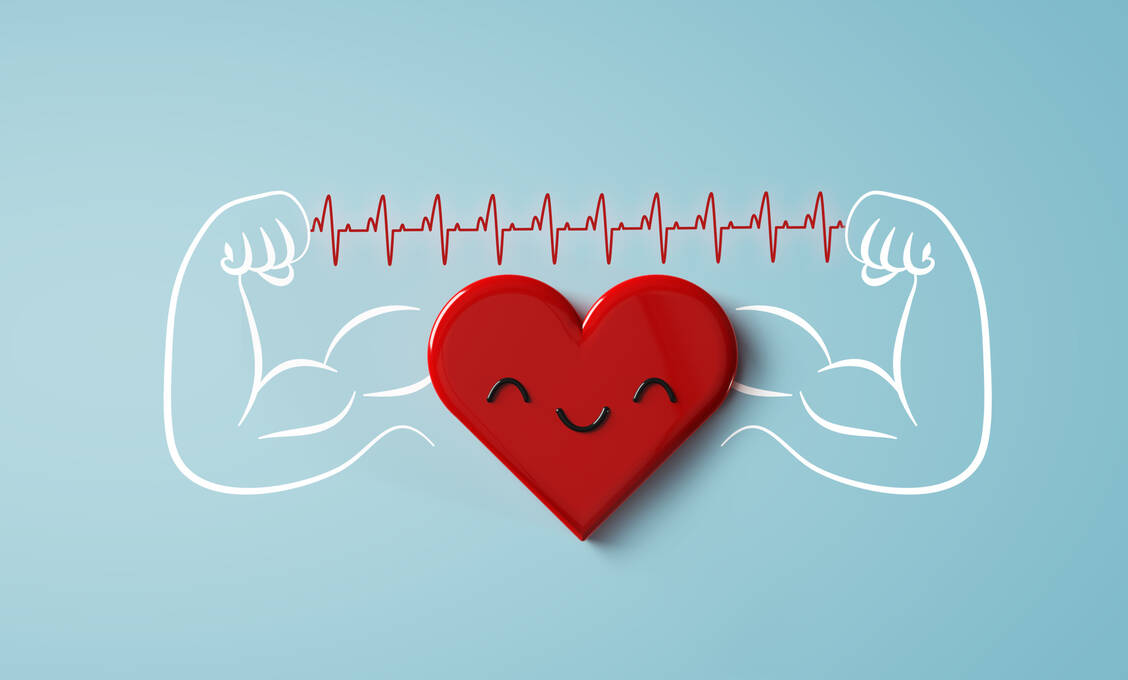Manche Patienten sind sich unsicher, ob eine Reise das Herz zu stark belasten könnte. Doch selbst größere Reisen, zum Beispiel mit dem Flugzeug, sind in der Regel kein Problem: »Solange es den Patienten gut geht, sollten sie normal leben, es mit der Anstrengung jedoch nicht übertreiben«, empfiehlt der Kardiologe. Etwas aufpassen sollten Patienten mit der Flüssigkeitsbilanz. Mehr als etwa 1,5 l zu trinken, kann das Herz belasten. Wenn es im Sommer oder am Urlaubsort jedoch sehr warm wird und der Patient aktiv ist, dürfen es auch mal mehr als 2 l sein. Eine regelmäßige Gewichtskontrolle morgens nach dem Wasserlassen gibt einen guten Hinweis, um ein Zuviel an Flüssigkeit zu vermeiden. Wichtig ist, dass die individuelle Trinkmenge mit dem Arzt besprochen wird.