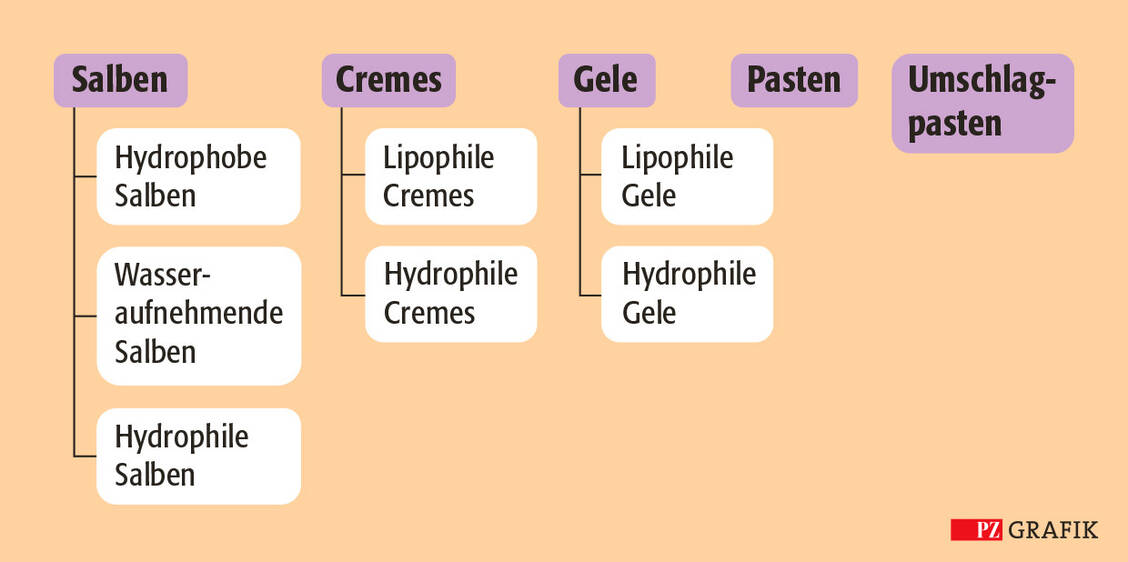Ist eine oberflächliche Wirkung beispielsweise bei Antiseptika oder Sonnenschutzprodukten erwünscht, ist eher eine Grundlage mit hydrophilen Eigenschaften zu verwenden. Es eignen sich Gele und hydrophile Cremes, aber auch flüssige Zubereitungen wie Sprays. Soll die Zubereitung hingegen ihre Wirkung in der Haut entfalten, müssen die wirksamen Bestandteile erst einmal in die Epidermis eindringen (Penetration).
Hydrophobe Salbengrundlagen fördern diese Penetration aufgrund ihres sogenannten Okklusionseffekts. Dabei schränkt die hydrophobe Zubereitung nach dem Auftragen auf die Haut deren Atmung ein und das Wasser von der Hautoberfläche kann nicht mehr verdunsten. Infolge staut sich das Wasser unter der Grundlage und die obere Zellschicht quillt auf. In der Zubereitung enthaltene Wirkstoffe können dann leichter in die Haut diffundieren. Dieser Effekt ist besonders bei chronischen Hautgeschehen sowie bei trockener und schuppender Haut erwünscht. Im Gegensatz dazu sind hydrophobe Grundlagen bei nässenden Hauterkrankungen ungeeignet, da sie den Wasserabtransport behindern.