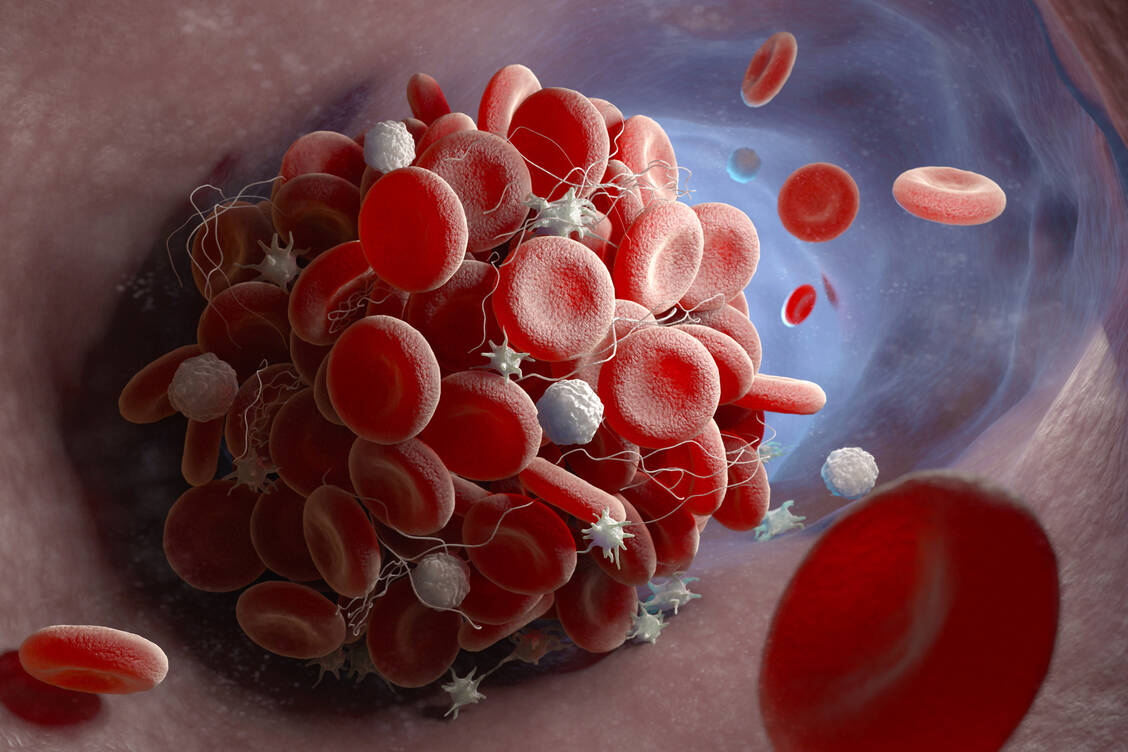Als typisches Anzeichen einer Thrombose gelten ziehende oder krampfartige Schmerzen, die einem Muskelkater ähneln und sich bei Druck auf die betroffene Stelle verstärken. Bei einer arteriellen Thrombose sind die Schmerzen stark ausgeprägt und vergehen auch in Ruhe nicht, Venenthrombosen können mitunter weitestgehend schmerzfrei verlaufen. Auffälliger sind in diesem Zusammenhang die Hautveränderungen, die durch eine Thrombose entstehen. Dazu gehören flächige oder strangförmige rötlich-blaue Verfärbungen und ein ungewöhnlicher Glanz der Haut. Zudem können betroffene Körperbereiche deutlich anschwellen.
Je nach Lage der Thrombose können weitere Symptome hinzukommen. So sind Thrombosen im Arm zwar relativ selten, in der Regel aber sehr schmerzhaft. Bei einer Thrombose im Bein treten zusätzlich Hitzegefühle im betroffenen Bein auf oder es fühlt sich ungewöhnlich warm an. Die Schmerzen bessern sich beim Hochlagern und können spontan und/oder belastungsabhängig auftreten. Wird das Bein tiefer gelagert, tritt ein Spannungsgefühl auf. Typisch sind auch Druckschmerzen an der Innenseite der Fußsohle (Payr-Zeichen), der Wade (Meyer-Zeichen) oder Wadenschmerzen, wenn der Fuß gebeugt wird (Homans-Zeichen). Entsteht als Folge der Thrombose eine Lungenembolie, können weitere Beschwerden hinzukommen. Dazu gehören leichte oder ausgeprägte Atemnot, Schwindel, große Angst und Unruhe.