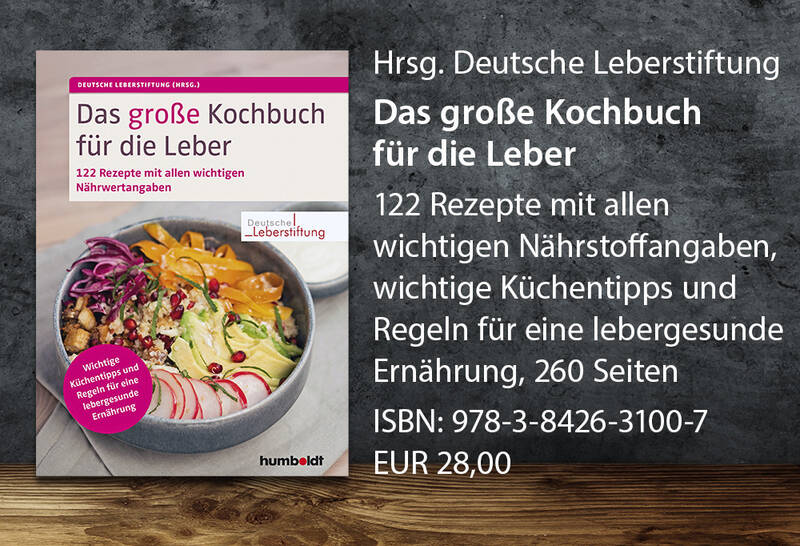Bisher gibt es keine medikamentöse Therapie, um die Leber vom überschüssigen Fett zu befreien. Die gute Nachricht ist jedoch, dass die Umstellung des Lebensstils der Fettleber effektiv entgegenwirkt. Während bei der AFL die Alkoholabstinenz im Vordergrund steht, kommt es bei einer NAFLD darauf an, Übergewicht abzubauen, die Ernährung anzupassen und für mehr Bewegung zu sorgen. Übergewichtige oder adipöse Patienten sollten laut der NAFLD-Leitlinie ihr Gewicht um mindestens 5 Prozent senken, um die Leberverfettung und Entzündungen, die damit einhergehen, entgegenzuwirken. Besteht bereits eine Leberfibrose, ist eine Gewichtsreduktion von mindestens 10 Prozent anzustreben.