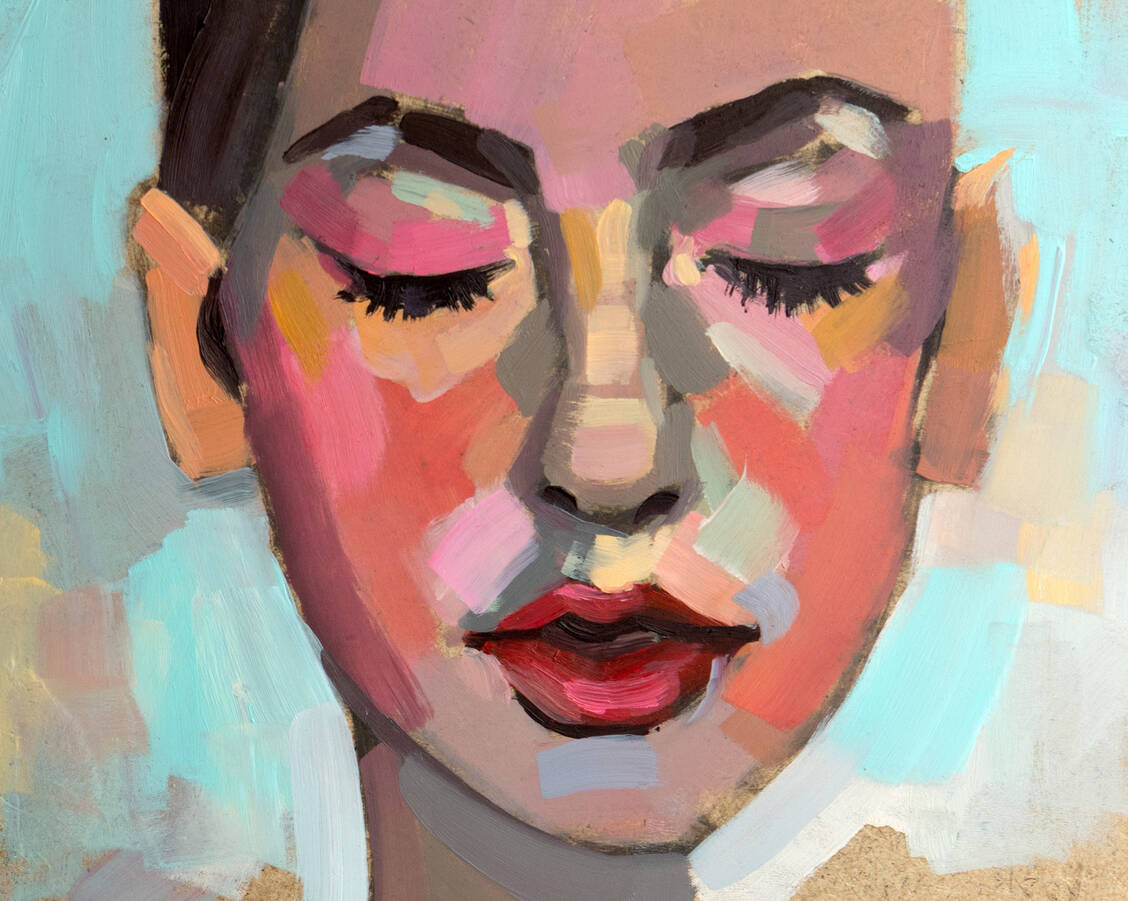Zu beachten laut Leitlinie: Allein durch die Verwendung von Wasser könne ein wesentlicher Anteil natürlicher Feuchthaltefaktoren (NMF) aus der Haut herausgelöst werden, was Patienten als unangenehmes Spannungsgefühl nach der Reinigung beschreiben. Hier empfiehlt sich der Einsatz von Reinigungsfluiden oder Mizellenwasser, welche ohne zusätzliches Wasser auskommen. So verbleiben die NMF, also etwa Aminosäuren, Glycerin oder Harnstoff, vermehrt in der Haut. Komplett verzichten sollten Patienten auf Gesichtswässer, mechanische oder chemische Peelings und Zubereitungen mit durchblutungsfördernden oder adstringierenden Inhaltsstoffen, also Alkohol, Menthol, Kampfer, Eukalyptus, Hamamelis oder Zinksulfat.