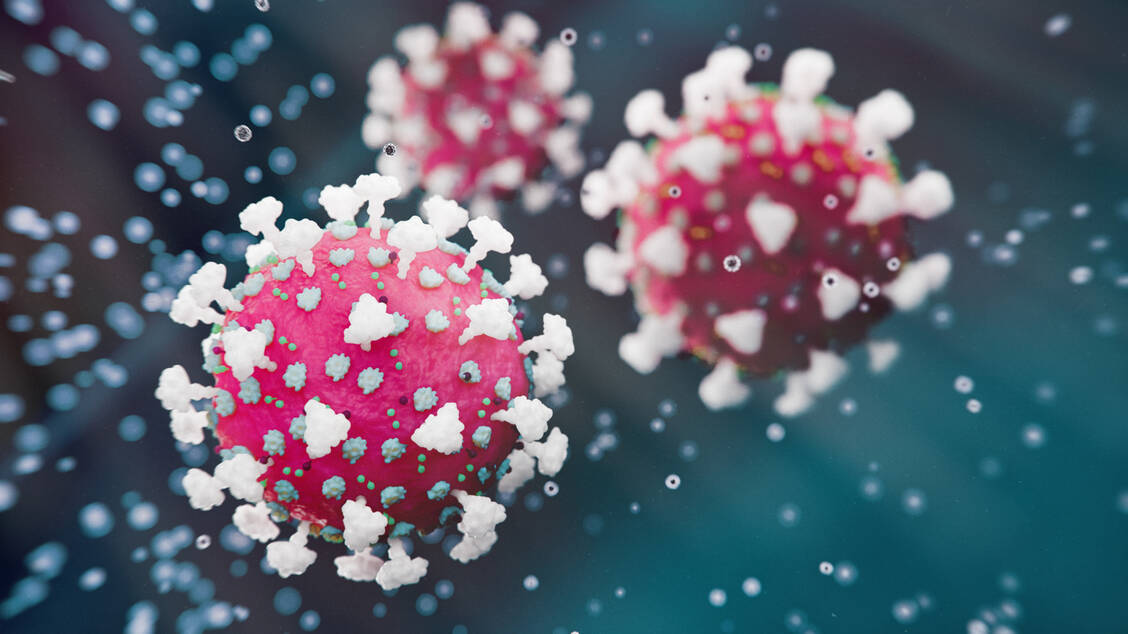Anders als der Kombinationspartner Amivantamab wird Lazertinib oral verabreicht. Die empfohlene Dosis beträgt 240 mg einmal täglich. Es wird dazu geraten, Lazertinib vor Anwendung des Antikörpers einzunehmen, wenn beide Pharmaka an einem Tag verabreicht werden. In der Fachinformation finden sich Hinweise zur Dosisreduktion von Lazertinib aufgrund von Nebenwirkungen. Sehr häufig kommt es zum Beispiel unter Lazertinib zu Ausschlag, Nageltoxizität, Hepatotoxizität, Stomatitis, venöser Thromboembolie, Parästhesie, Ermüdung, Magen-Darm-Beschwerden, trockener Haut, vermindertem Appetit und Juckreiz.