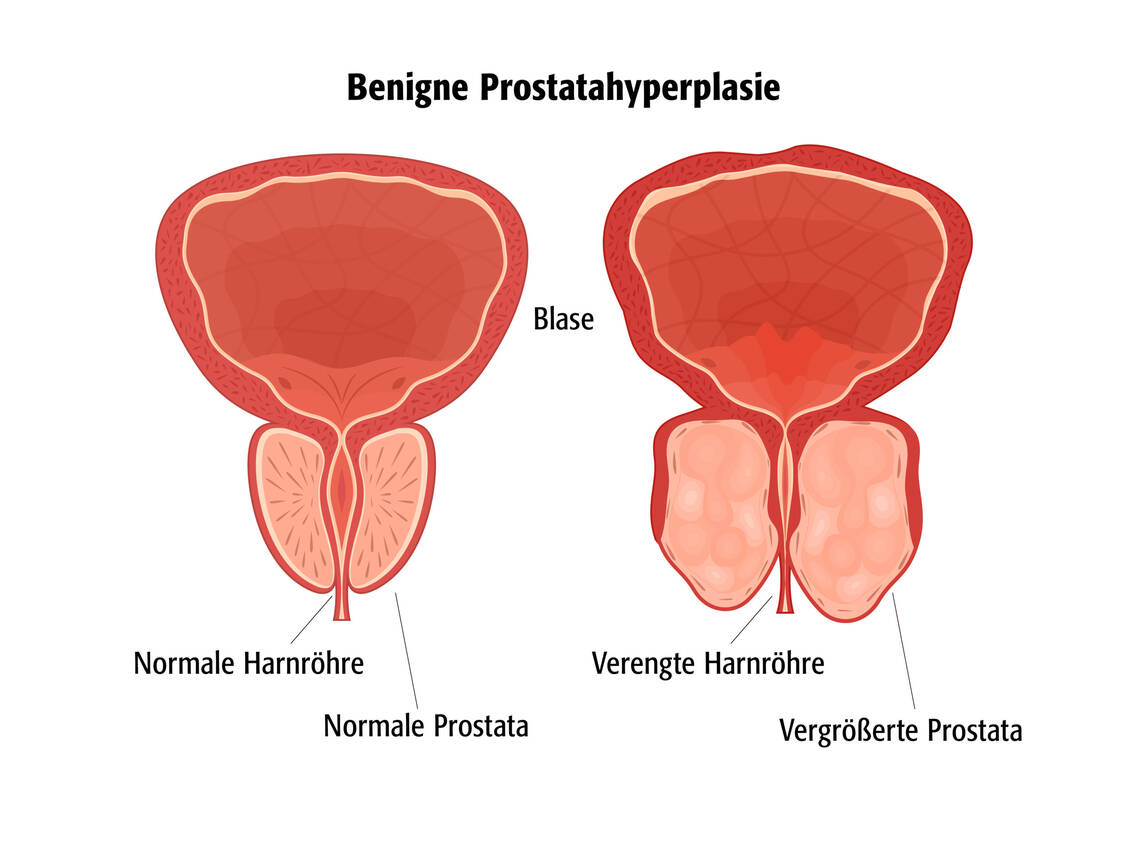»Das Tückische ist, dass die Prostatavergrößerung schleichend kommt und deshalb oft gar nicht so recht wahrgenommen wird«, weiß Storz. Irgendwann bemerken Betroffene, dass es mit dem Wasserlassen nicht mehr so gut klappt, wie noch vor ein paar Jahren. Sie haben das Gefühl, häufiger auf Toilette zu müssen, verspüren Startschwierigkeiten, der Harnstrahl stottert und die Blase entleert sich nicht mehr vollständig oder es tröpfelt nach. Einige Patienten müssen zudem nachts vermehrt zur Toilette. Vielen Männern würde erst bewusst, dass etwas nicht stimmt, wenn der Arzt bei der Vorsorgeuntersuchung gezielt nach Beschwerden fragt, sagt Storz.