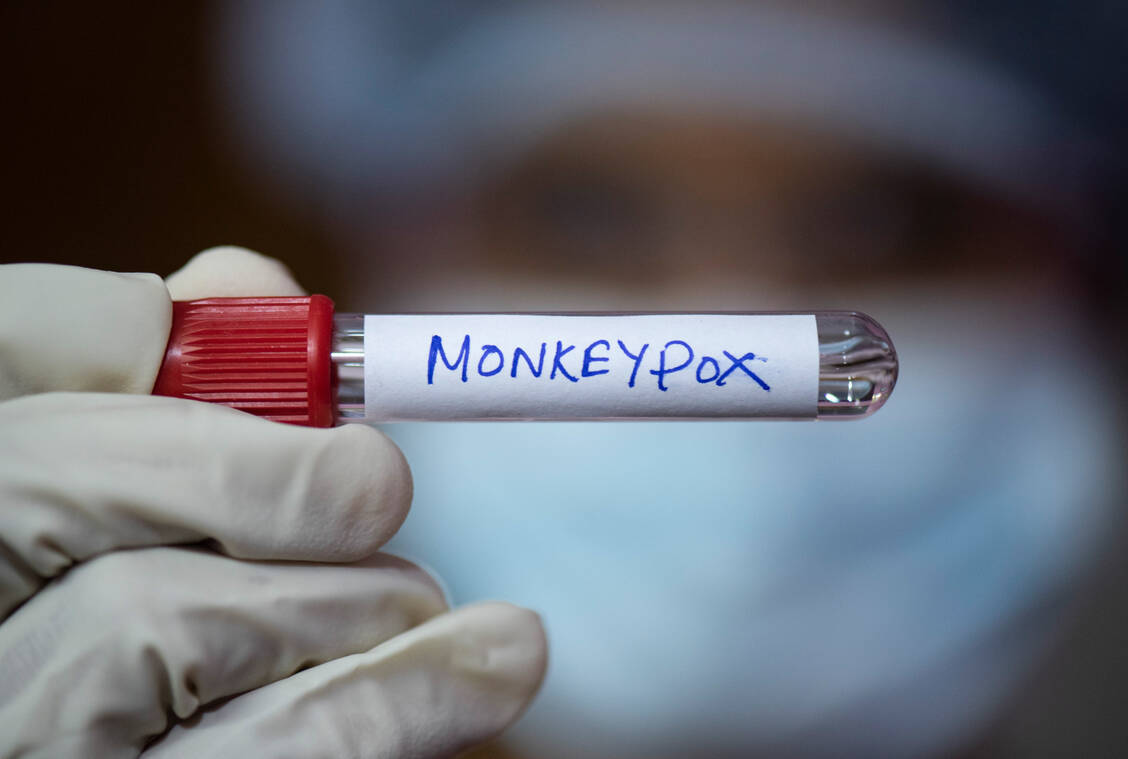Das Mpox-Virus wird überwiegend durch engen Haut-zu-Haut-Kontakt übertragen, also etwa beim Sex, engen Umarmungen, Massieren und Küssen. Ansteckungsgefahr besteht vor allem bei Infizierten mit Ausschlag, Wunden oder Schorf. Typische Symptome einer Infektion sind plötzlich auftretendes Fieber, starke Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Halsschmerzen, Husten und Lymphknotenschwellungen, ebenso ein pockentypischer Hautausschlag, der im Gesicht beginnt und dann auf den Körper übergeht. Die Hautveränderungen durchlaufen verschiedene Stadien und verkrusten, die Krusten fallen schließlich ab. Es können dauerhaft Narben zurückbleiben.