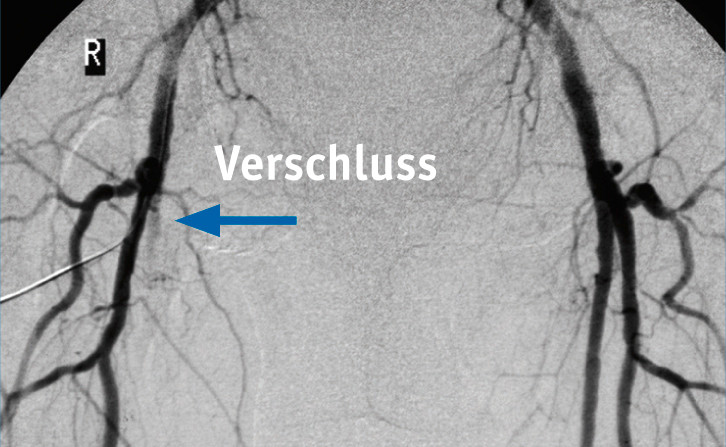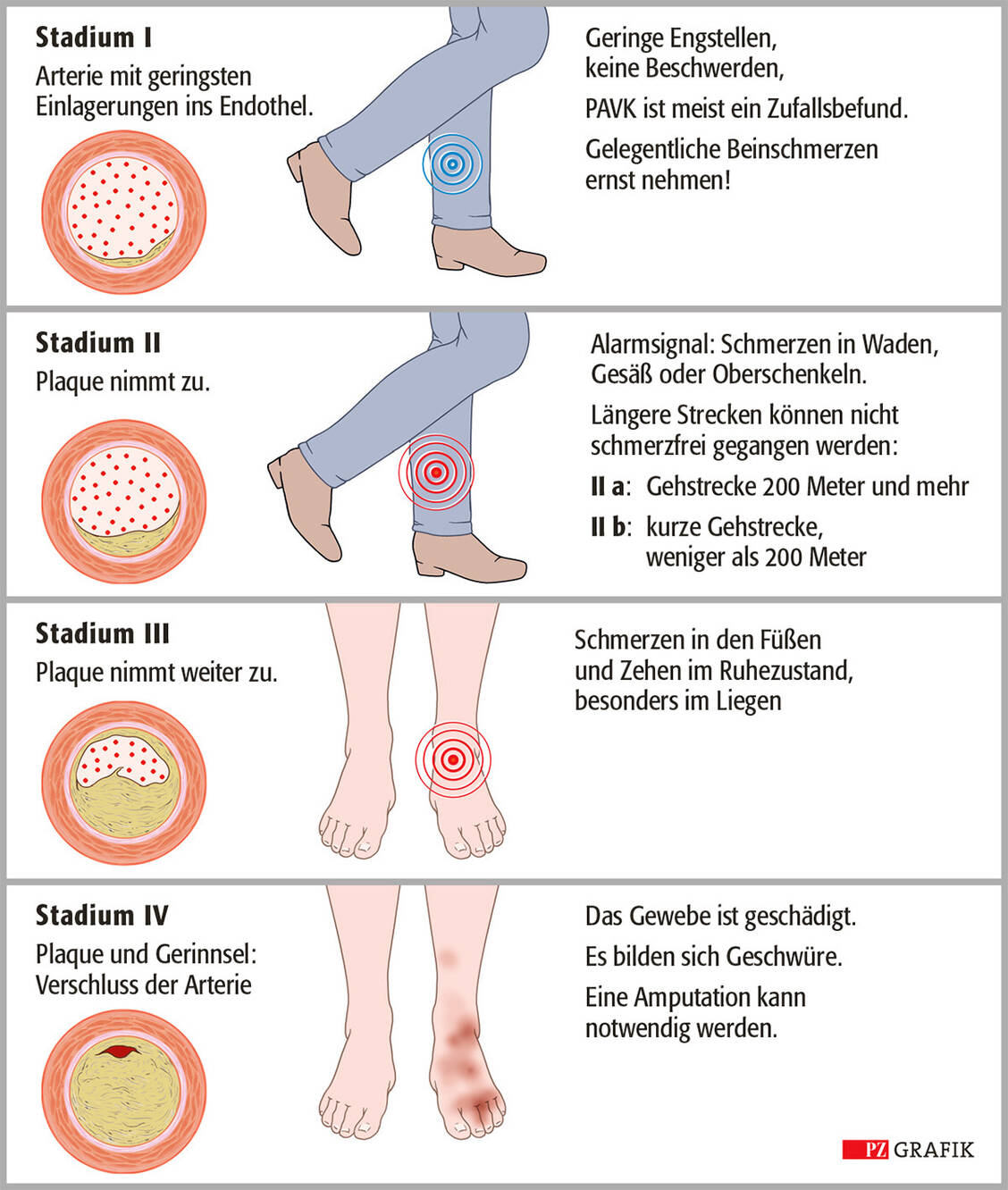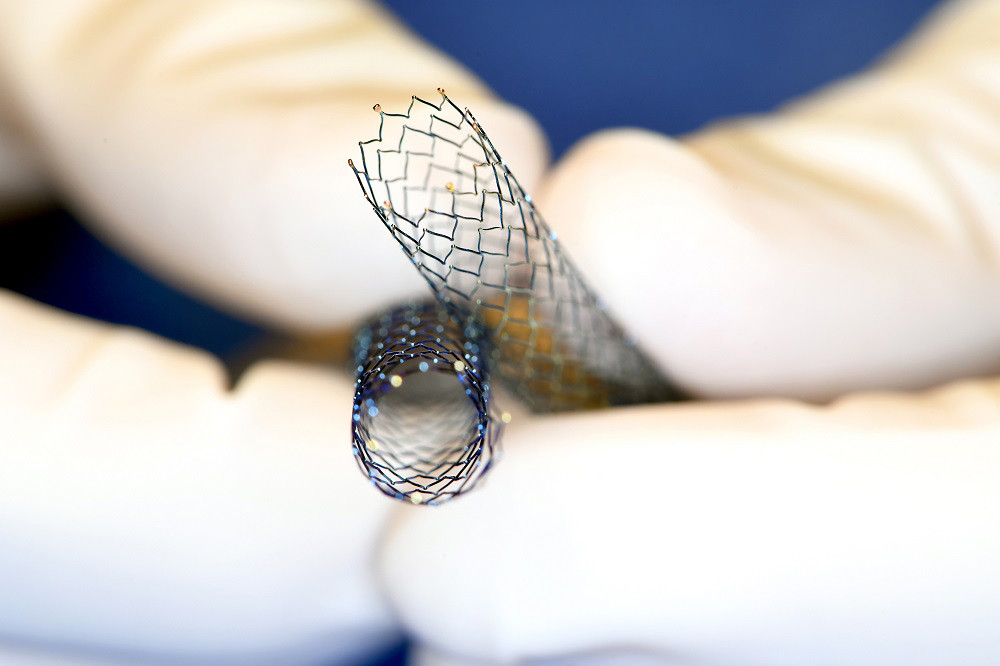Die Diagnose PAVK an sich ist nicht aufwendig. »Mithilfe der Dopplerdruckmessung steht eine schnelle, schmerzfreie und ungefährliche Untersuchungsmethode zur Verfügung, die zuverlässig auf die Engpässe in den Beinen hinweist. Sie zeigt eine PAVK schon zu einem Zeitpunkt an, zu dem noch keine Beschwerden auftreten«, informiert Lawall. Dabei ist der sogenannte Knöchel-Arm-Index (medizinisch ABI = Ankle-Brachial-Index) in allen Stadien der Erkrankung ein wichtiger Indikator für die Veränderungen in den Blutgefäßen.
Dabei wird der Blutdruck mit einer Blutdruckmanschette und einer Dopplersonde sowohl an den Oberarmen als auch an den Fußknöcheln gemessen. Anschließend wird der systolische Wert für den Knöchel mit dem für den Arm ins Verhältnis gesetzt. Bei gesunden Gefäßen sind die Werte an Arm und Bein annähernd gleich und der ABI liegt bei etwa 1,0. Bei einem Quotienten unter 0,9 liegt definitionsgemäß eine PAVK vor. Je niedriger der ABI, desto ausgeprägter die Durchblutungsstörungen und desto stärker sind auch die Beschwerden.
Wird etwa am Knöchel ein Blutdruck von 100/70 mm Hg und am Arm von 125/80 mm Hg gemessen, ergibt sich daraus ein ABI von 0,8 (= 100/125). In den Beinblutgefäßen liegt somit eine leichte PAVK vor.