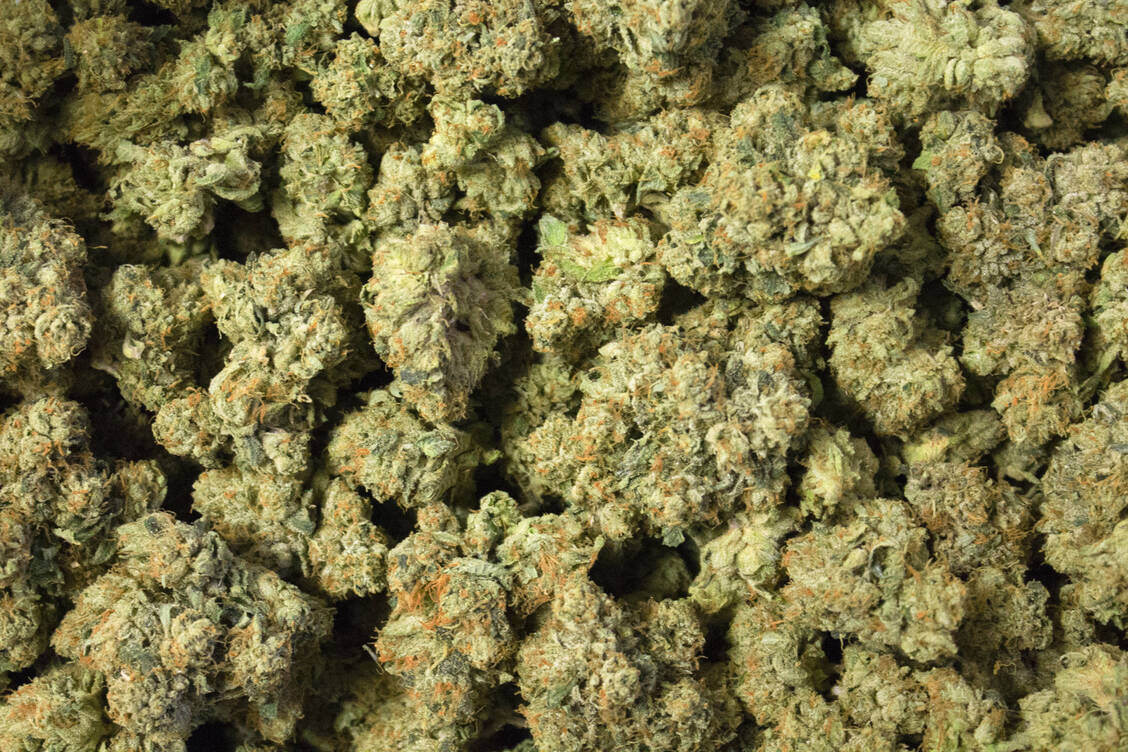Die vorgestellten Ergebnisse sind Teil eines Abschlussberichts zu einer Begleiterhebung, die der Gesetzgeber beauftragt hatte. In die Auswertung seien seit 2017 anonymisierte Daten zu rund 21.000 Behandlungen eingeflossen, schreibt das BfArM. Zwar waren Ärzte zur Übermittlung der anonymisierten Daten verpflichtet, jedoch sei dies wegen der weitgehenden Anonymisierung faktisch freiwillig erfolgt. Das Bundesinstitut erklärte, die Erhebung der Behandlungsdaten aus der ärztlichen Praxis sei wertvoll, um vor allem Hinweise zu Anwendungsgebieten von Cannabis-Arzneimitteln und zu Nebenwirkungen einer Therapie zu erhalten.