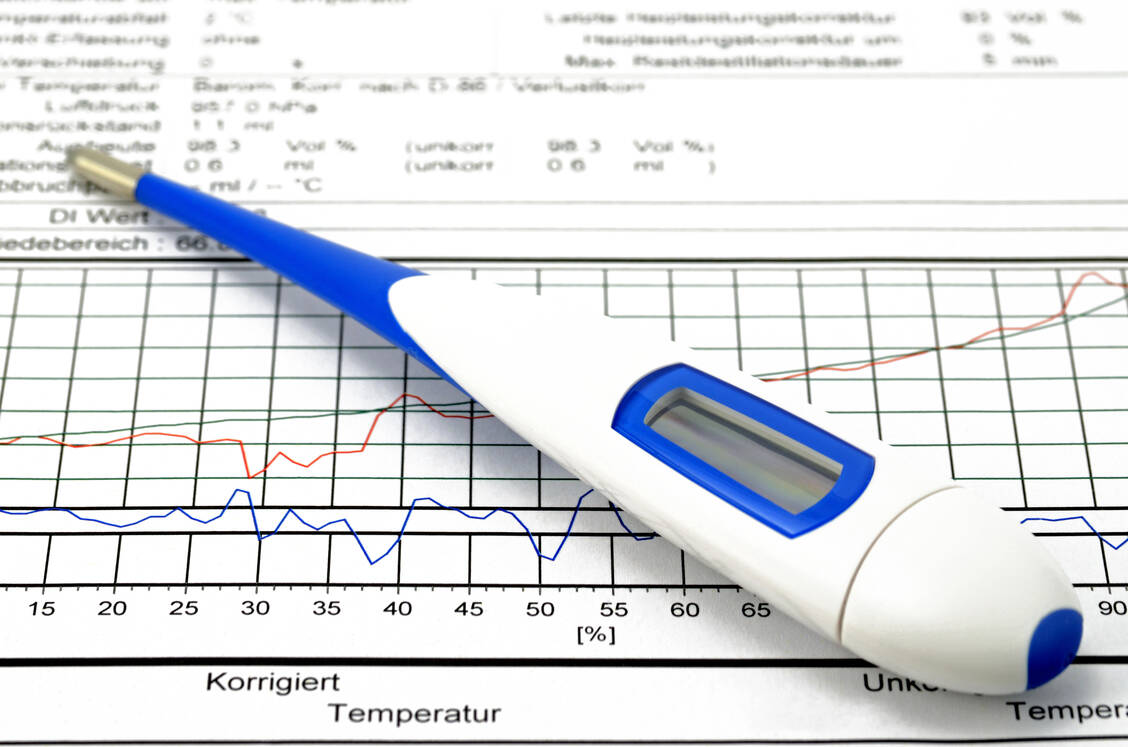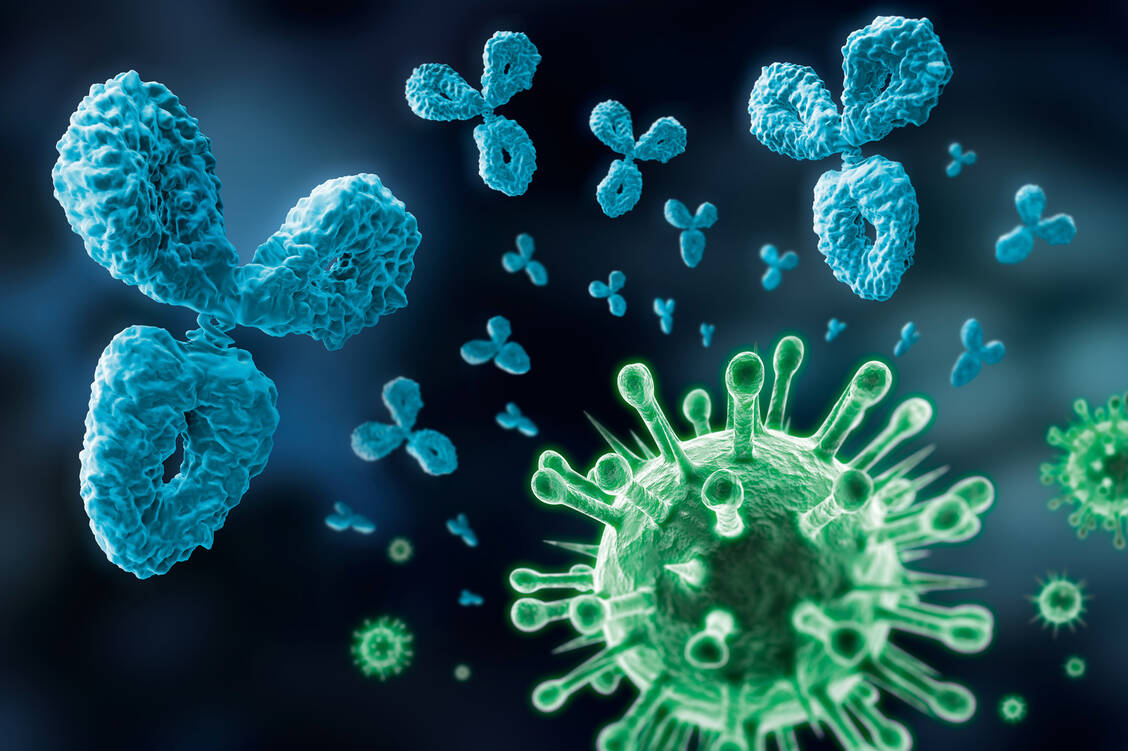Ob Fieber gesenkt wird oder nicht, sollte deshalb eine individuelle Entscheidung sein. Fühlt sich der Patient trotz Fieber fit, ist nichts dagegen einzuwenden, ihn »fiebern« zu lassen. Bringt das Fieber jedoch Begleitsymptome mit sich, die ein starkes Krankheitsgefühl vermitteln, ist der Einsatz von Antipyretika sinnvoll.
Bei sehr hohen Temperaturen von mehr als 40 °C wird empfohlen, das Fieber medikamentös zu senken. Auf das Auftreten von Fieberkrämpfen hat eine frühzeitige antipyretische Therapie keinen Einfluss. Dies sollte Eltern unbedingt immer wieder gesagt werden, um ein zwanghaftes Fieber messen bei jedem sich eventuell anbahnenden Infekt zu vermeiden.