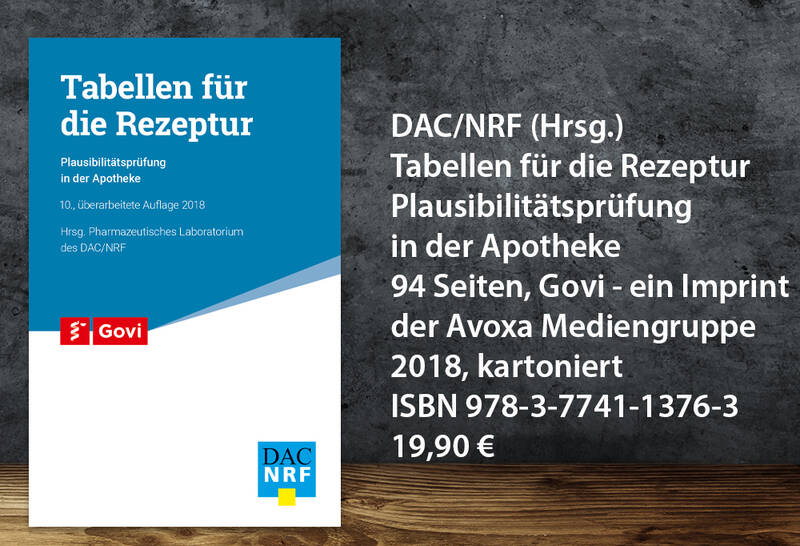In der Mitte des Kreuzes wird die Untersuchungslösung mit Hilfe einer Mikrokapillare je nach Vorschrift mit einem Fassungsvermögen von 1, 2 oder 5 µl so lange aufgetupft, bis unter der UV-Lampe eine deutliche Fluoreszenzlöschung auftritt. Der Fleck nach Abdunsten des Lösungsmittels sollte nicht größer sein als 2 mm. Bei bandenförmiger Auftragung (Drogen und andere Vielstoffgemische) sind schmale Zonen von 2 mm Breite bis zu 10 mm Länge anzustreben. Die Untersuchungs- sowie Vergleichssubstanzen müssen immer komplett gelöst vorliegen.
Dazu wird die vorgeschriebene Menge in ein kurzes Reagenzglas eingewogen und das vorgeschriebene Lösungsmittel ergänzt. Da dieses recht schnell verdampft, ist zügiges Arbeiten ratsam. Praktisch veranlagte Apothekenmitarbeiter lösen aus Zeitgründen eine Spatelspitze Untersuchungssubstanz direkt auf eine Tüpfelplatte. Es kann jedoch zu einer sogenannten »Schwanzbildung« kommen, denn die Konzentration der zu untersuchende Substanz ist zum Teil einfach zu hoch.