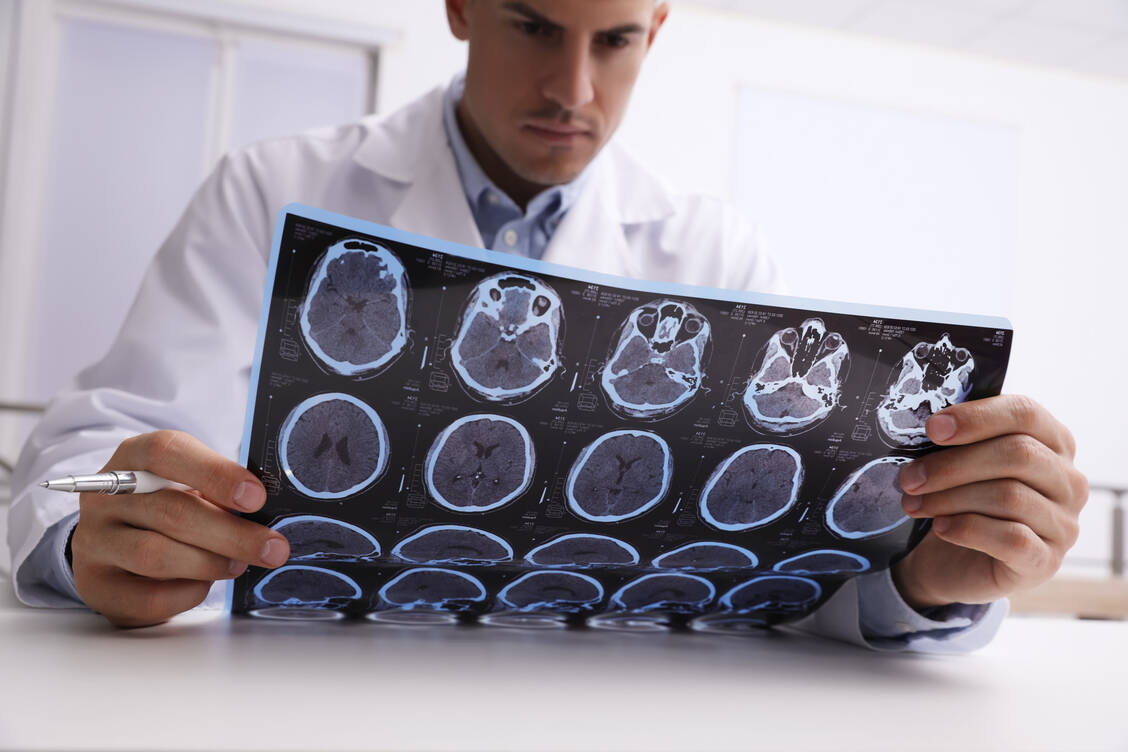ApoE4 ist eine von drei Varianten des Gens, das für das Eiweiß Apolipoprotein E (ApoE) codiert. Seit mehr als 30 Jahren weiß man um die Bedeutung des ApoE4-Allels als wichtigen genetischen Risikofaktor für die Alzheimer-Krankheit. So haben Träger eines ApoE4-Allels ein deutlich höheres Risiko, die Erkrankung zu entwickeln, als Träger des ApoE3-Allels.
Eine Studie kam kürzlich zu dem Ergebnis, dass homozygote ApoE4-Träger, das heißt Träger von zwei Kopien des Gens, etwa 15 bis 20 Prozent aller Alzheimer-Patienten ausmachen, obwohl weltweit nur 2 bis 4 Prozent der Bevölkerung diese genetische Risikokonstellation aufweisen. Die Studie stellte außerdem zur Diskussion, dass es sich beim homozygoten Auftreten des Allels um eine genetische Form der Alzheimer-Krankheit handelt.