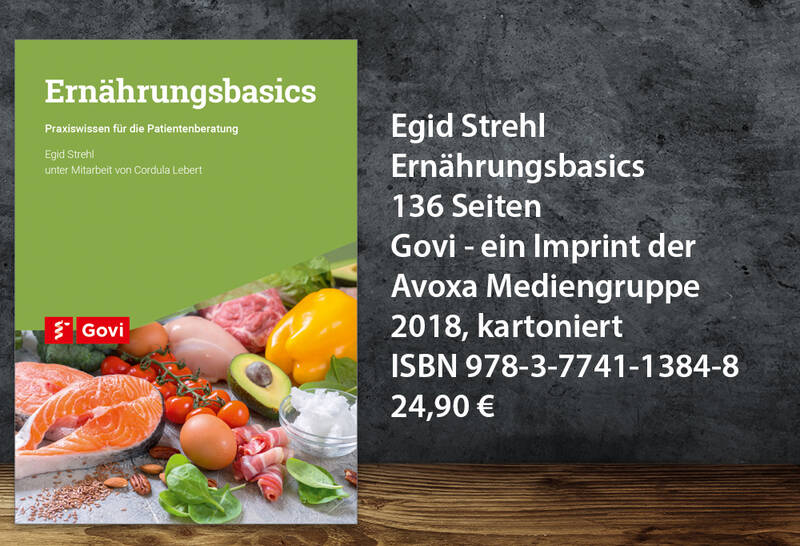Um langsam abzunehmen, gelten etwa 500 kcal weniger pro Tag als gutes Maß. Ein Ziel, das sich erreichen lässt, indem der Übergewichtige kleinere Portionen isst und energieärmere Nahrungsmittel wählt. Am einfachsten gelingt das, wenn er an der Fettzufuhr spart. Doch auch »low carb« verspricht laut Leitlinien Erfolg. Somit kann jeder seinen persönlichen Geschmacksvorlieben folgen. Eine Kost mit 1500 bis 2000 kcal pro Tag schmeckt und sättigt, wenn sie viel Obst, Gemüse und Vollkornprodukte enthält. Hat der Patient sein Zielgewicht erreicht, kann er diese Kost - leicht ausgeweitet - im Grundsatz beibehalten. Formula-Diäten wie Optifast®, Modifast® oder Almased® können für Abnehmwillige eine Hilfe sein, um überhaupt den ersten Schritt Richtung Gewichtsreduktion zu gehen. Sie ersetzen dann in der Regel ein bis zwei Hauptmahlzeiten. Schrittweise werden die Formula-Mahlzeiten später wieder durch normale Lebensmittel ersetzt. Die Mahlzeiten sollten dann jedoch gegenüber früheren Ernährungsgewohnheiten weniger Kalorien enthalten.