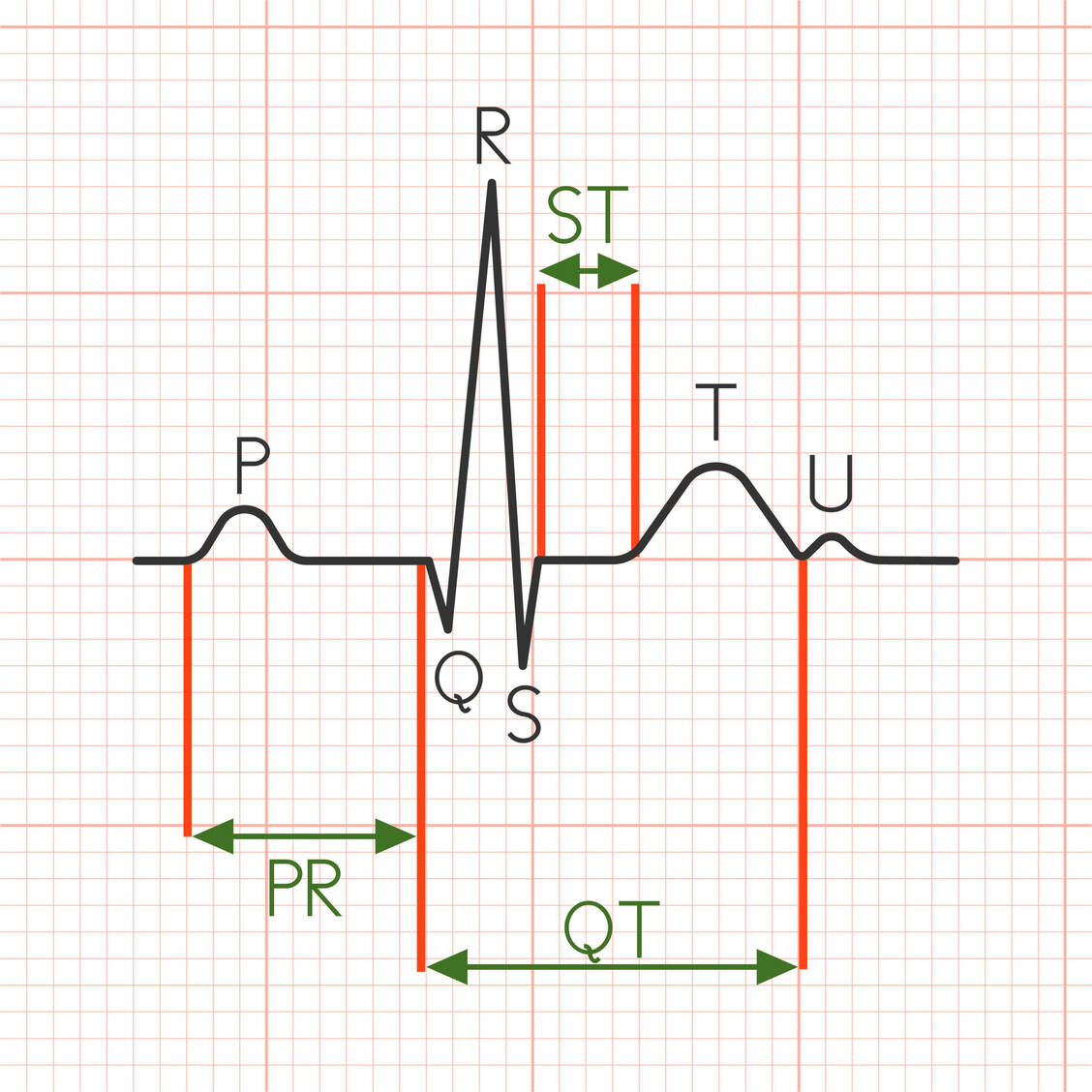Das Spektrum der Arzneistoffe, die das QT-Intervall verlängern, ist breit. Fast immer hemmen sie einen bestimmten Kaliumkanal in der Herzmuskelzelle, den HERG-Kaliumkanal (HERG = human ether-à-go-go-related gene). Dieser ist für die Repolarisation mitverantwortlich. Die Bindungsstelle im Kanal ist sehr unspezifisch, was erklärt, warum so viele, strukturell unterschiedliche Arzneistoffe ihn blockieren können.
Nicht immer ist bewiesen, dass QT-verlängernde Wirkstoffe auch das Risiko für Torsades de pointes (TdP) erhöhen. Manchmal sind zusätzliche Faktoren ausschlaggebend, wie eine sehr hohe Dosis, eine durch Interaktionen erhöhte Plasmakonzentration oder Hypokaliämie.