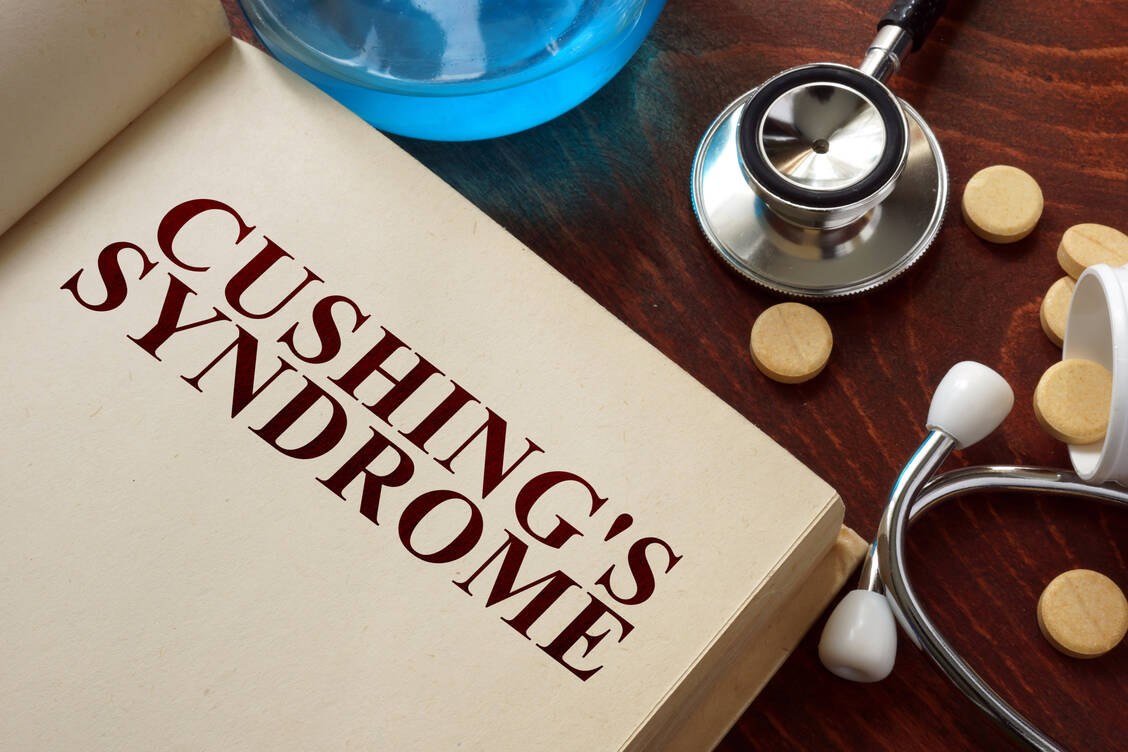Eine Impfung während der Behandlung mit Ozanimod sowie bis zu drei Monate danach kann weniger wirksam sein. Die Anwendung von attenuierten Lebendimpfstoffen kann ein Infektionsrisiko bergen und sollte daher während der Behandlung mit dem Wirkstoff und für bis zu drei Monate danach vermieden werden.
Was gibt es in Sachen Wechselwirkungen zu bedenken? Die gleichzeitige Anwendung von Inhibitoren des Brustkrebsresistenz-Proteins (BCRP), MAO-Hemmern oder CYP2C8-Induktoren mit Ozanimod wird nicht empfohlen. Das kann zu erhöhten beziehungsweise erniedrigten Spiegeln des MS-Medikaments führen und damit dessen Wirksamkeit oder Sicherheit beeinflussen.