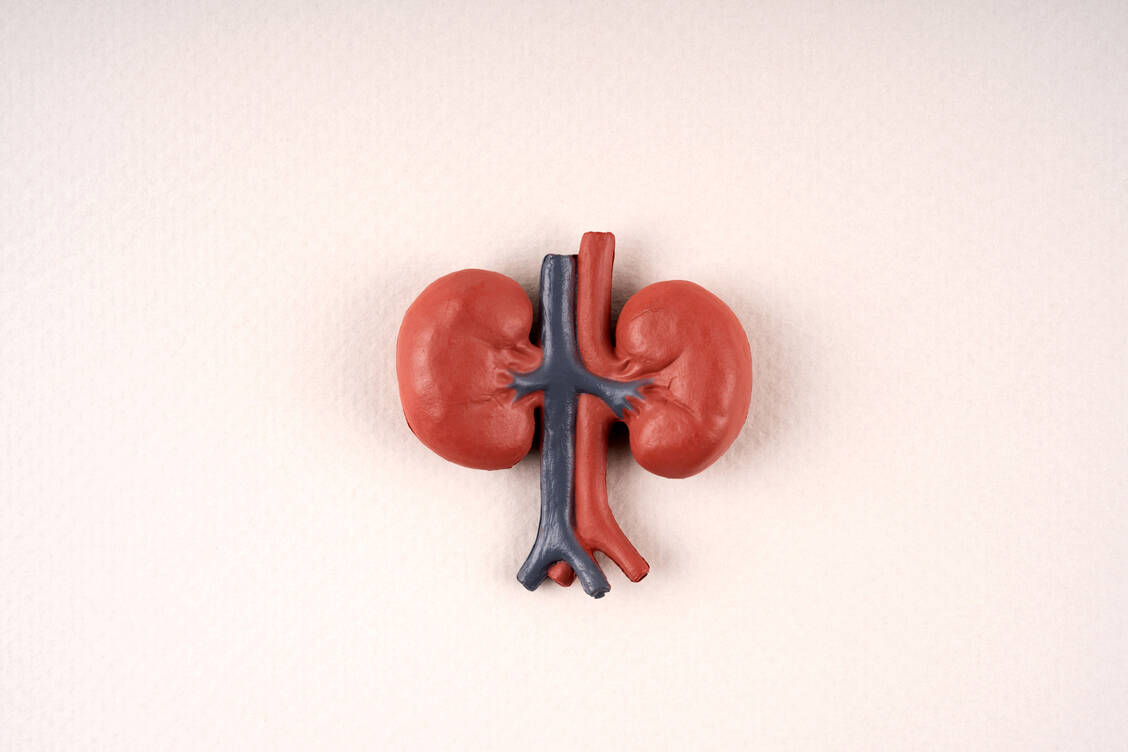Neben der glomerulären Filtrationsrate ist der Albumin-Kreatinin-Quotient (UACR) im Urin ein wichtiger, aber aktuell noch nicht breit eingesetzter Marker. »Der Verlust von Albumin über die Niere ist ein frühes Zeichen dafür, dass die Niere einen Filterdefekt hat«, so Professor Dr. Markus van der Giet, Internist und Urologe an der Charité Berlin sowie Vorstandsvorsitzender der Deutschen Hochdruckliga (DHL), bei einer Online-Diskussionsrunde anlässlich des Weltnierentags. Die UACR wird unter anderem für Risiko-Scores benötigt, die das Progressionsrisiko zum Nierenversagen ermitteln, und ist relevant für Therapieentscheidungen (RAAS-Blockade, SGLT-2-Hemmer).