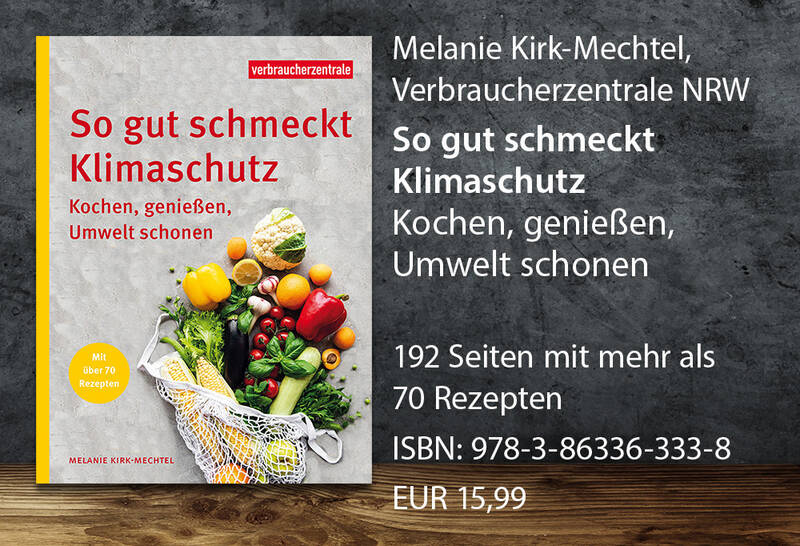Für die Fleischproduktion werden weltweit rund 80 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen genutzt, darunter 67 Prozent Gras- und Weideland. Der Anbau von Futtermitteln benötigt große Flächen und bedingt gar Monokulturen und Brandrodung – Ackerfläche, die wiederum für den Anbau pflanzlicher Lebensmittel fehlt.
»Wenn es gelänge, immer häufiger auf pflanzliche Lebensmittel zu setzen, könnten wir unseren persönlichen Klimafußabdruck beträchtlich verkleinern.« Das klingt mahnend, aber Expertin Klein weiß auch, dass mit einer Verbotskultur nichts zu bewegen ist. »Essgewohnheiten sind tief in uns verwurzelt, da lassen wir uns ungern hineinreden. Wir müssen den Menschen die Last nehmen, dass sie alles falsch machen. Sie sollen nicht komplett aufhören, Fleisch zu essen, aber wenn, dann bewusst und nachhaltig produziertes Biofleisch aus der Region.«