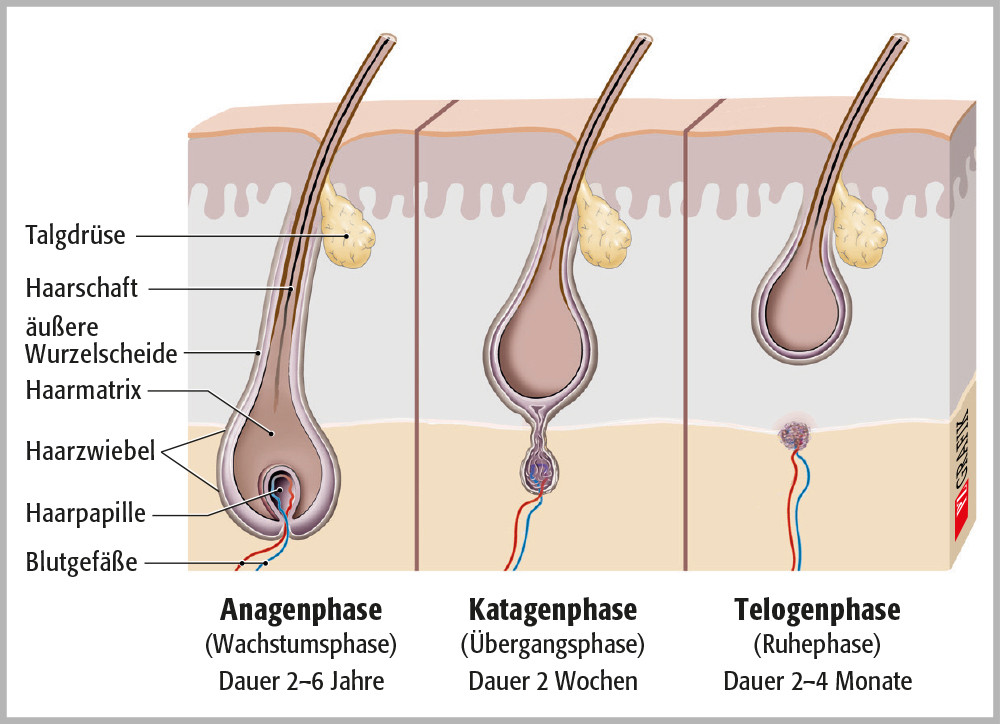Minoxidil gibt es zudem als Schaum, der laut Lutz allerdings leicht in den Haaren hängen bleibt und zum Teil die Kopfhaut nicht gut erreicht. Lutz empfiehlt, die erforderliche Menge Schaum in die Kappe zu geben, um ihn in der Hand oder mit dem Föhn zu erwärmen. Der so verflüssigte Schaum lässt sich mit einer Pipette gut aufnehmen und auf die Kopfhaut auftragen. Dafür eignen sich Einmalpipetten, die mehrfach verwendet werden können. Wenn Patienten die im Beipackzettel aufgeführten Nebenwirkungen befürchten, könnte man sie beruhigen, weiß Lutz. Ursprünglich wurde Minoxidil als Antihypertensivum zugelassen. Die vermehrte Flaumbehaarung im Gesicht als mögliche Nebenwirkung der systemischen Therapie war ein Zufallsbefund, der letztlich zur Entwicklung der Lösung gegen Haarausfall führte. Obwohl bei äußerlicher Anwendung nur eine sehr geringe Resorption des Wirkstoffs stattfindet, sind im Beipackzettel der Lösung alle Nebenwirkungen aufgeführt, die bei der Tabletteneinnahme auftreten können. Auch zeigt der klinische Alltag, dass bei Patienten, die bereits Blutdrucksenker einnehmen, die äußerliche Therapie nicht zusätzlich den Blutdruck senkt.