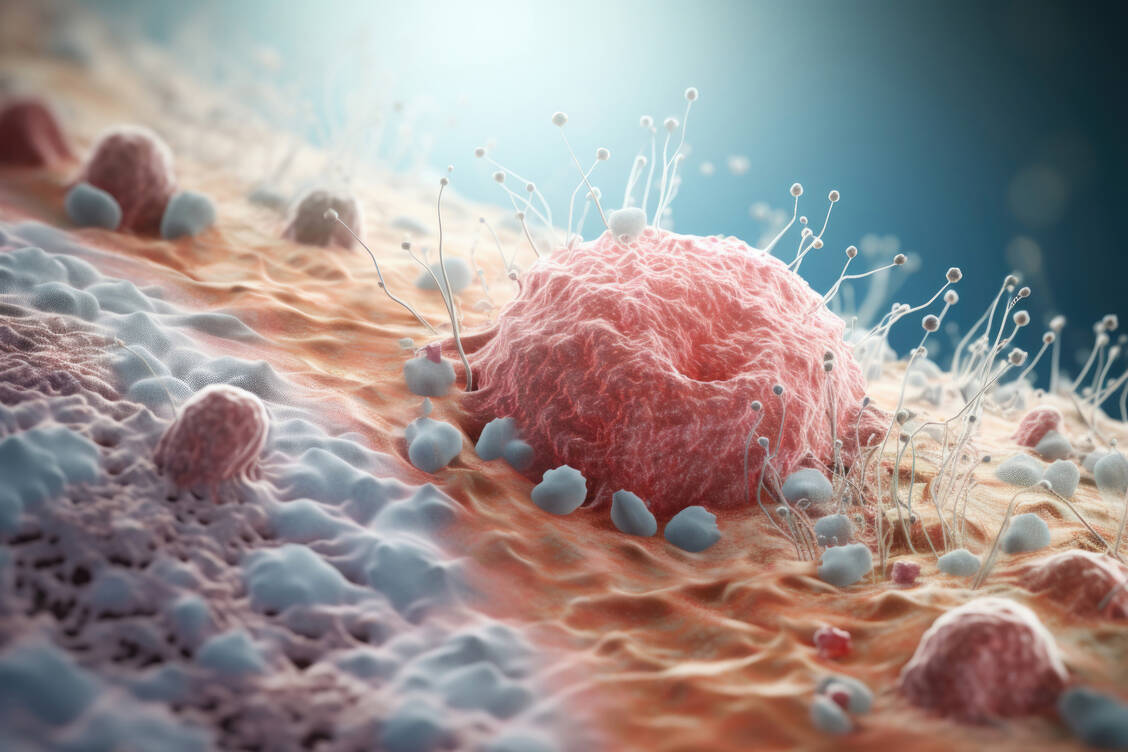Die entnommene Gewebeprobe wird im Labor mikroskopisch untersucht. Ein Pathologe bewertet die Zellen, um festzustellen, ob sie krebsartig sind, und, falls ja, welche Art von Hautkrebs vorliegt. Bei bestätigtem Hautkrebs können zusätzliche Untersuchungen erforderlich sein, um das Ausmaß der Erkrankung zu bestimmen. Um zu prüfen, ob der Krebs sich auf nahe gelegene Lymphknoten ausgebreitet hat, werden die Lymphknoten untersucht. Bildgebende Verfahren wie Röntgen, CT, MRT oder PET-Scans können verwendet werden, um eine Ausbreitung auf andere Körperteile auszuschließen oder zu bestätigen. Die Ergebnisse der pathologischen Untersuchung und der weiteren Untersuchungen werden verwendet, um das Stadium des Hautkrebses zu bestimmen. Die Behandlungsstrategie legt der Arzt je nach Krankheitsstadium fest.