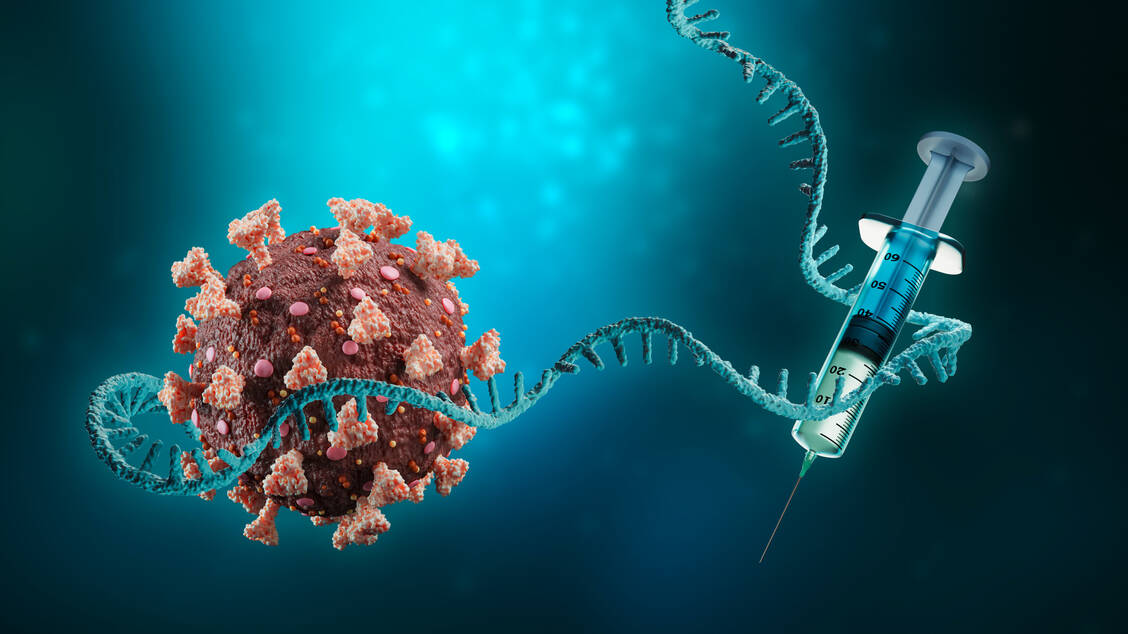Ein oft betonter Vorteil der mRNA-Plattform ist ihre Flexibilität. Impfstoffe lassen sich in kurzer Zeit designen und vergleichsweise einfach skalieren. Um eine weltweite Produktion und Versorgung zu erreichen, entwickelte Biontech zum Beispiel mobile Produktionsanlagen, die sogenannten »BioNTainer«. Sie könnten eine dezentrale Herstellung vor Ort ermöglichen und damit die Impfstoffversorgung in Entwicklungs- und Schwellenländern nachhaltig verbessern.
Die schnell skalierbare Produktion kann im Falle einer neuen Pandemie einen Vorteil bedeuten. Jedoch: Es gibt noch technische Hürden. Die mRNA und Lipidnanopartikel sind bislang noch empfindlich gegenüber Hitze, weshalb Kühlketten in der Herstellung und Verteilung optimiert werden müssen. Dazu müssen Langzeitsicherheit und Immunogenität in weiteren Studien bestätigt werden.