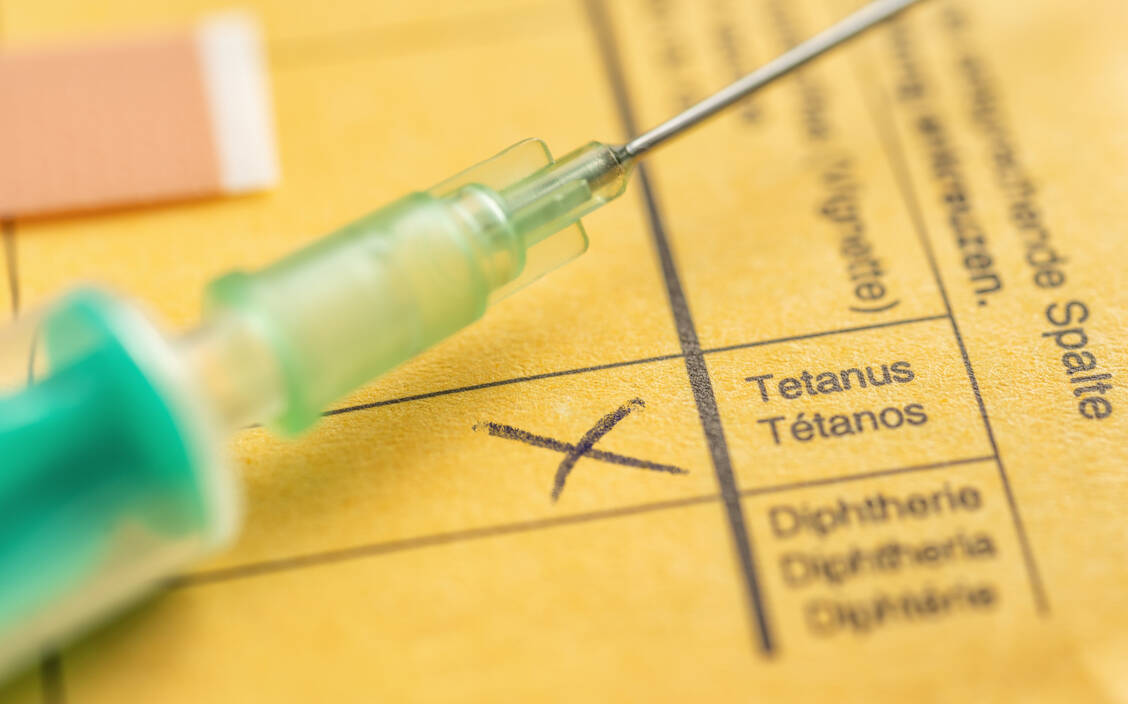Um hingegen Lebendimpfstoffe herzustellen, werden Keime vermehrt, die durch Mutationen so verändert sind, dass sie nicht mehr krankmachen können. Die Herausforderung besteht darin, einen geeigneten Stamm oder Klon von Viren zu finden, der stabil ist und nicht wieder zu einem virulenten Stamm zurückmutiert. Lebendimpfstoffe sind vernehmungsfähig und lösen anders als Totimpfstoffe auch eine zelluläre Immunantwort aus, die die Aktivierung von zytotoxischen T-Zellen einbezieht. Eine Auffrischungsimpfung ist nicht immer erforderlich. Bis auf einige Ausnahmen dürfen sie allerdings nicht an Immunschwache verabreicht werden, da die Betroffenen durch die Impfung erkranken könnten. Auch Schwangere können mit einigen Lebendimpfstoffen nicht geimpft werden. Für die Apotheke ist wichtig, dass die Impfstoffe eine konsequente Kühllagerung benötigen. Beispiele für abgeschwächte Impfstoffe sind die Vakzine gegen Masern-Mumps-Röteln (MMR), Windpocken, Gürtelrose, Gelbfieber, Rotavirus oder der nasale Lebendimpfstoff gegen Grippe (LAIV, live attenuated influenza vaccine).