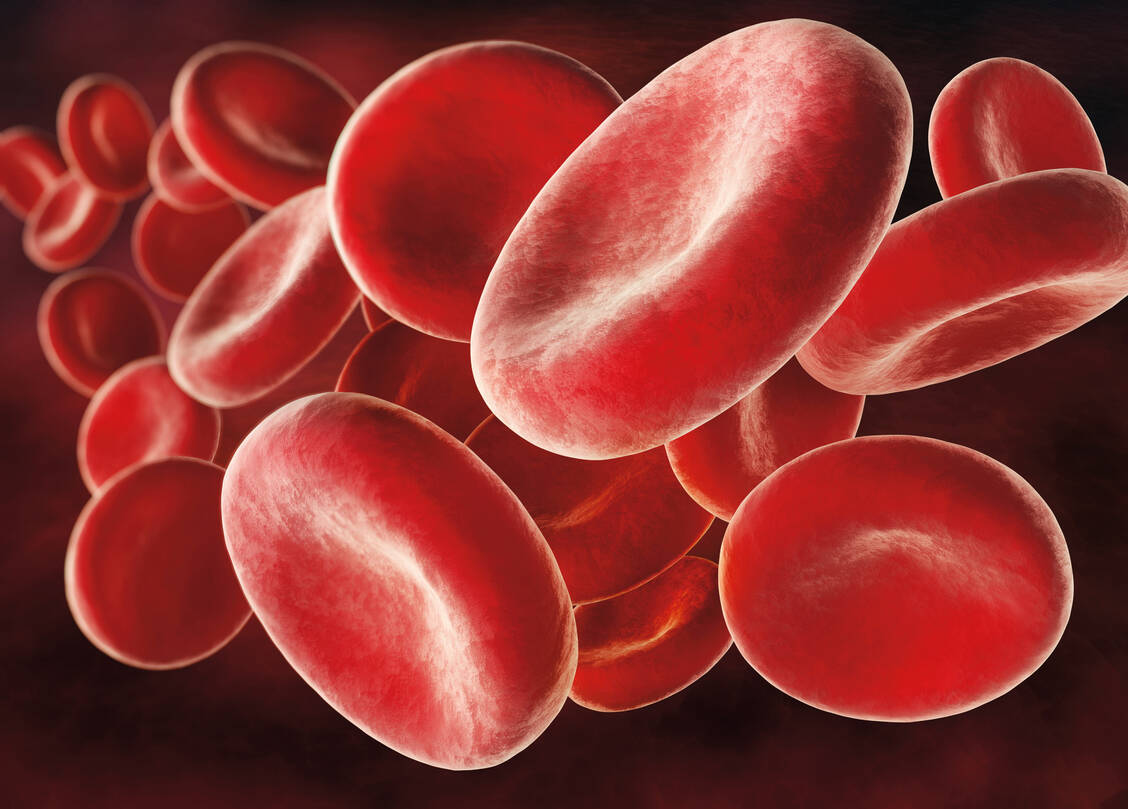Das Plattenepithelkarzinom der Haut (cutaneous squamous cell carcinoma, cSCC) ist eine der am häufigsten diagnostizierten Hautkrebsarten weltweit. Schätzungen zufolge nimmt die Inzidenz in einigen Ländern erheblich zu. Obwohl die überwiegende Mehrzahl der Patienten mit cSCC eine gute Prognose hat, wenn die Erkrankung frühzeitig entdeckt wird, ist dieser Krebs in fortgeschrittenen Stadien oft schwierig zu behandeln.
Cemiplimab ist zur Behandlung erwachsener Patienten mit metastasiertem oder lokal fortgeschrittenem cSCC, die nicht für eine kurative Operation oder Bestrahlung in Betracht kommen, vorgesehen. Es ist die bisher einzige Therapie, die in der EU für das fortgeschrittene cSCC zugelassen ist. Allerdings wurde das Medikament zunächst »unter besonderen Bedingungen« zugelassen. Dies bedeutet, dass weitere Nachweise für das Arzneimittel erwartet werden, die das Unternehmen bereitstellen muss.