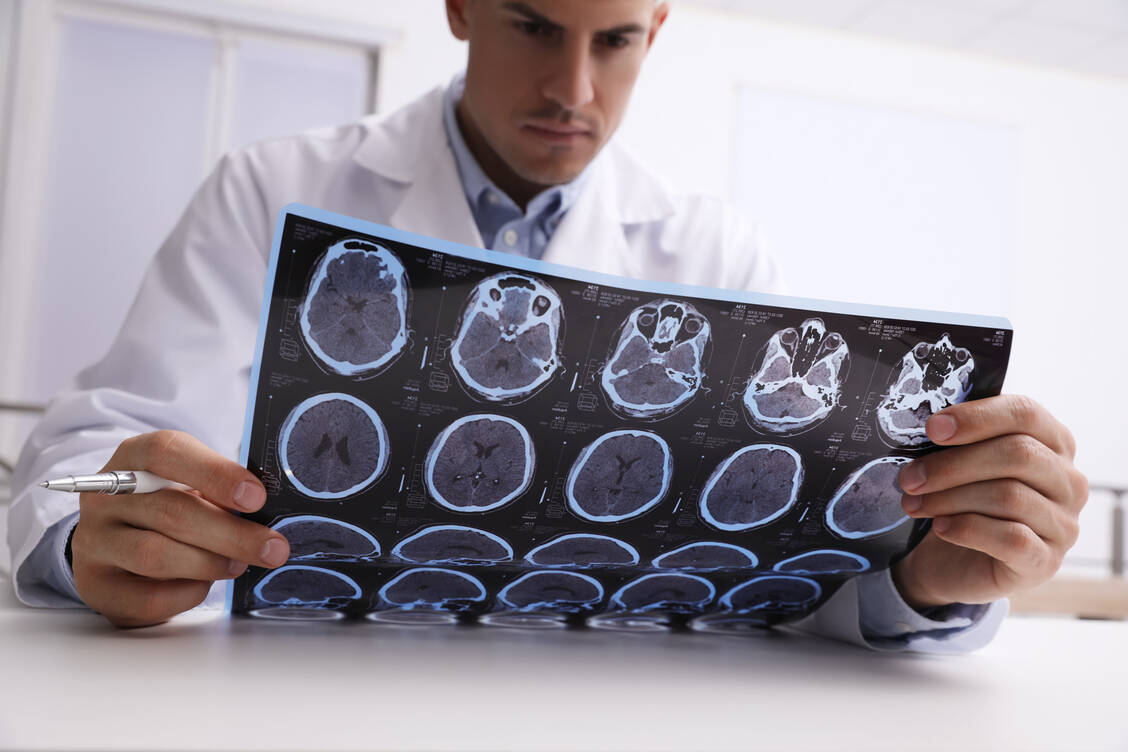Auch sportliche Aktivität trägt viel dazu bei, die Lebensqualität von MS-Patienten zu verbessern: Sie lindert nachweislich Beschwerden wie Fatigue, Spastiken, Muskelschwäche, Depressionen, Koordinations- und Gleichgewichtsprobleme. Am besten geeignet ist ein ausgewogener, mäßig anstrengender Mix aus Ausdauer- und Krafttraining. Kurzfristig kann Sport allerdings die Symptome verschlechtern. Schuld ist das sogenannte Uhthoff-Phänomen: Durch die erhöhte Körpertemperatur verringert sich die Leitfähigkeit in den von der MS beeinträchtigten Abschnitten im Zentralnervensystem. Mediziner wissen heute aber, dass diese Verschlimmerung ungefährlich ist und nach 30 Minuten bis zwei Stunden wieder verschwindet. Durch kühle Umschläge, Arm- oder Fußbäder kann man das beschleunigen.
Lina hat gelernt, sich mit ihrer MS zu arrangieren. Ihre Erfahrungen teilt sie auf Instagram (@lina.mein.leben.mit.ms) und auf ihrer Website (linameinlebenmitms.de). Die Erkrankung habe ihr Leben auf den Kopf gestellt, sagt sie – vieles jedoch auch zum Positiven verändert: »Die MS bringt mich oft an meine Grenzen, aber sie hat mich auch zu einem sehr starken Menschen gemacht, den so schnell nichts umhaut.« Und sie habe ihr beigebracht, was im Leben wirklich zählt: »Zum Beispiel, am Morgen aufstehen zu können. Und glücklich zu sein.«