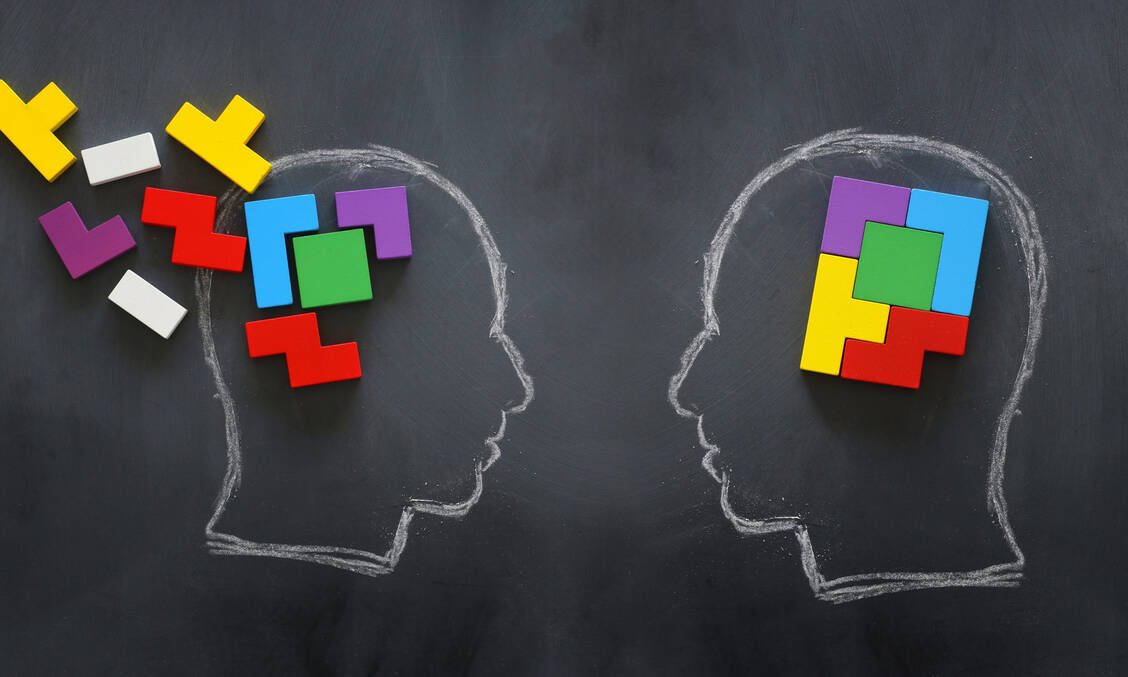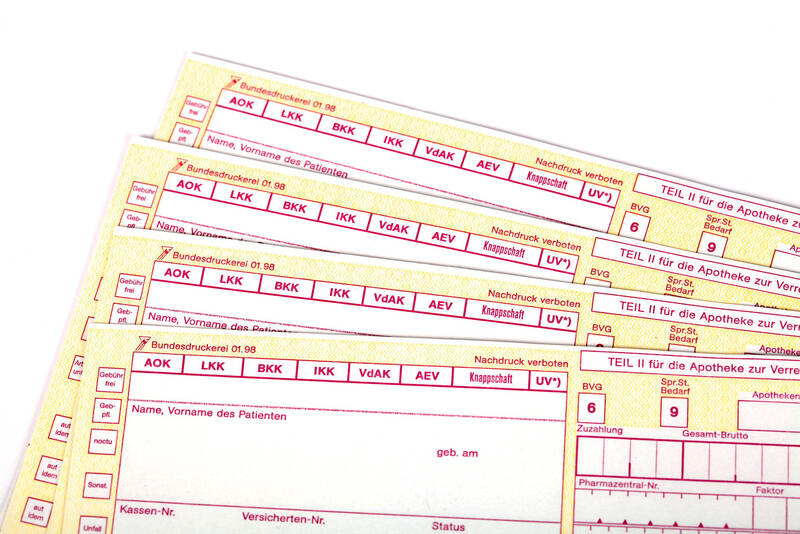Pharmakologisch werden zwei Substanzklassen eingesetzt: Stimulanzien wie Methylphenidat, Amphetamin oder Dexamfetamin sowie die Nicht-Stimulanzien Atomoxetin und Guanfacin. Psychostimulanzien heben die Stimmung, vermindern Müdigkeit und steigern die Leistungsfähigkeit. Leider bringen sie ein hohes Missbrauchspotenzial mit sich, was viele Betroffene oder Eltern zunächst ängstigt. Methylphenidat (zum Beispiel in Ritalin®, Medikinet®) ist ihr bekanntester Vertreter und in der Regel die erste Wahl. Es greift je nach Dosis in die Freisetzung verschiedener Neurotransmitter wie Noradrenalin, Serotonin und Dopamin ein.
Auf den ersten Blick wirkt es widersprüchlich, unruhige Kinder mit einem Stimulans zu behandeln. Doch in niedriger, oraler Dosierung erhöhen sie unter anderem die Dopamin-Konzentration im synaptischen Spalt gerade nur so viel, dass hemmende Autorezeptoren verstärkt stimuliert werden. Unter dem Strich reduzieren sie damit die Dopamin-Freisetzung. Dieser Effekt verbessert bei ADHS das impulsive Verhalten, reduziert die Unruhe und unterstützt Problemlösendes Denken. Durch die Freisetzung von Noradrenalin verstärken Stimulanzien außerdem die Wirkung des Sympathikus, sodass häufig Nebenwirkungen wie Blutdrucksteigerung, Herzrasen, Appetitmangel und Gewichtsabnahme auftreten.