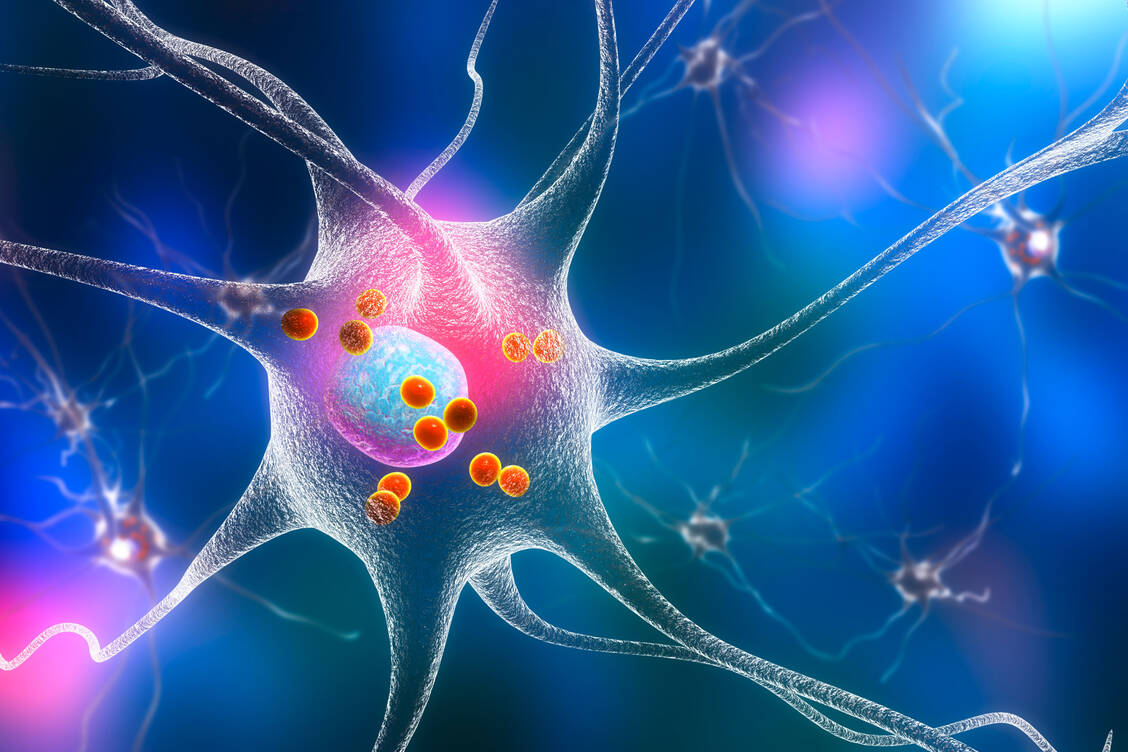Ein Parkinsonpatient ist leicht an seinen verlangsamten Bewegungsabläufen zu erkennen. Es ist so, als müsse der Betroffene immer erst eine Hemmschwelle überwinden, bis er zu sprechen oder zu gehen beginnt. Charakteristisch sind auch die verminderte Mimik, das maskenhaft erstarrte
Gesicht und der kleinschrittige schlurfende Gang. Diese Symptome werden unter dem Begriff Akinese zusammengefasst. Weitere Leitsymptome sind Rigor (Versteifung der Muskulatur, erhöhter Muskeltonus und das Gefühl von »Gebundenheit«) und Tremor, hier zunächst ein einseitiges Zittern besonders der Hände, die sich unter Stress und Ruhe verstärken können. Dazu klagen Patienten über gestörte Gang- und Standreflexe. Im Verlauf der Krankheit verstärken sich diese Beschwerden und werden häufig von psychischen Veränderungen wie depressiver Verstimmung und Kognitionseinschränkungen begleitet. Belastend sind unter Progression der degenerativen Prozesse auch vegetative Einschränkungen, zum Beispiel Inkontinenz, vermehrter Speichelfluss, Obstipation, sexuelle Funktionsstörungen und die seborrhoische Gesichtshaut.