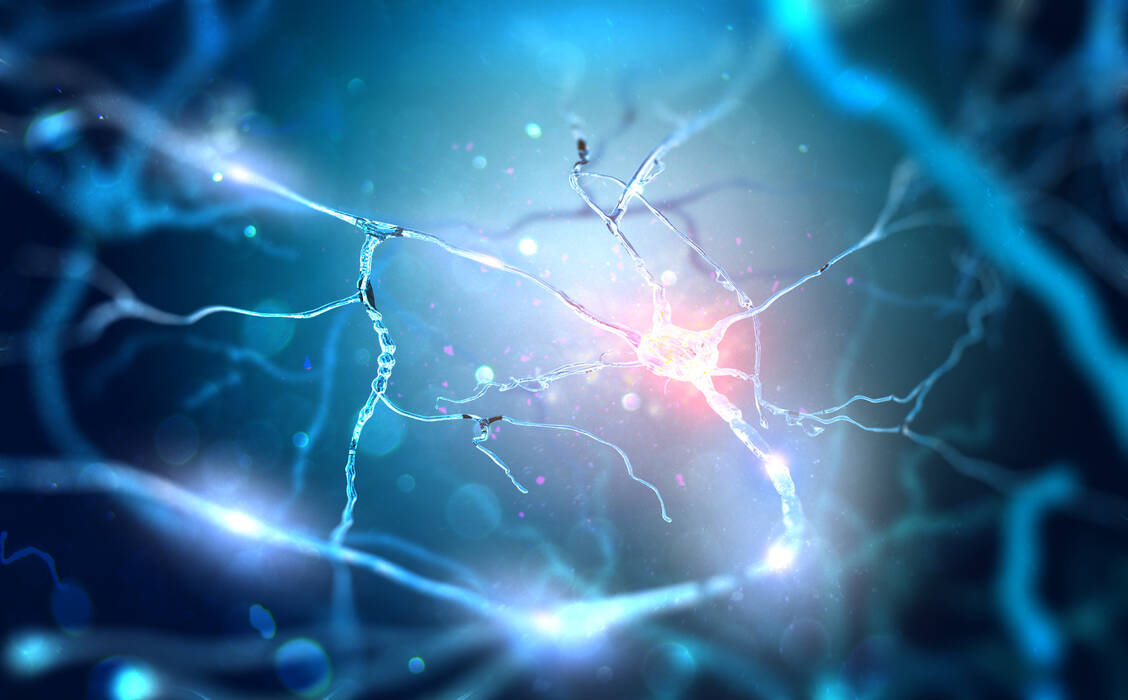Sie betonen, dass MS-Erkrankte, die keine immunmodulierende Therapie erhalten oder mit Interferon beta beziehungsweise Glatirameracetat behandelt werden, grundsätzlich nicht mehr gefährdet sind als gleichartige gesunde Personen. Besteht eine stärkere Behinderung (Rollstuhl, Bettlägerigkeit) ist das Risiko für Atemwegsinfektionen generell erhöht, da die Lunge weniger gut belüftet ist. »Das heißt nicht, dass das Infektionsrisiko höher ist als bei Gesunden, aber das Risiko, bei einem Kontakt mit dem Corona-Virus schwer zu erkranken, ist größer«, sagen die Neurologen.
Eine Cortisol-Stoßtherapie könne das Infektionsrisiko kurzfristig steigern. Daher müsse der behandelnde Arzt bei leichten Schüben eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Abwägung vornehmen. Mit regelmäßigen, in Intervallen verabreichten Cortisol-Therapien sollte nach Einschätzung von Gold und Haas zunächst pausiert werden.
Ist eine Schubtherapie unumgänglich, so müsse anschließend ein erhöhter Schutz vor einer möglichen Covid-19-Infektion gewährleistet sein. Hilfreich und sinnvoll könne es sein, bei Berufstätigkeit gegebenenfalls eine begrenzte Arbeitsunfähigkeit in Anspruch zu nehmen.