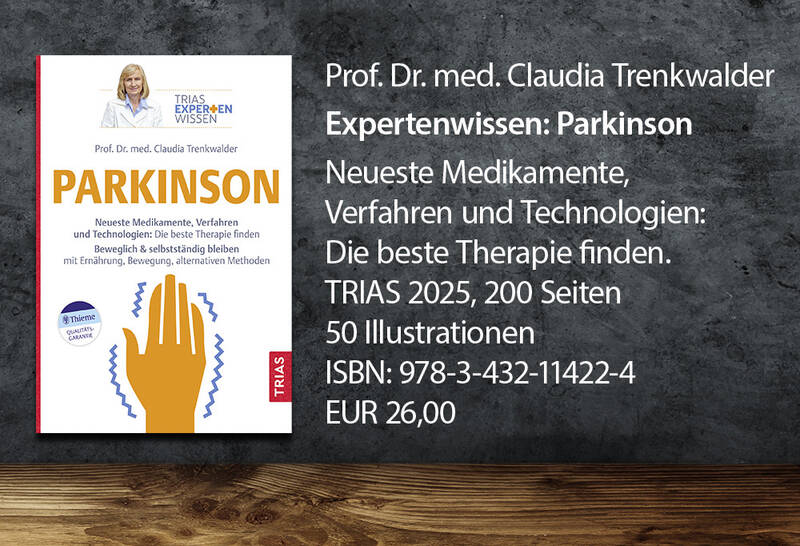Inzwischen erhalten Parkinson-Patienten nicht erst bei deutlich ausgeprägten Symptomen eine dopaminerge Therapie, sondern viel früher, weil sich hierdurch ihre Lebensqualität laut Trenkwalder deutlich verbessert. Die Neurologin stellt klar: »Dass L-Dopa mit der Zeit seine Wirkung verliere, ist ein Mythos. Es wirkt immer auf die Symptome, die es verbessern kann wie Unbeweglichkeit, Steifigkeit und größtenteils das Zittern. Aber auf andere Symptome hat es keinen Einfluss wie Probleme mit dem Gleichgewicht oder Verwirrtheit, die mit der Dauer der Erkrankung und fortgeschrittenem Alter in den Fokus rücken können.« Trenkwalder wünscht sich, dass auch verstärkt depressive Verstimmungen und Depressionen mitbehandelt werden, an denen viele Erkrankte leiden. Derzeit würden diese oft nicht oder zu spät erkannt.