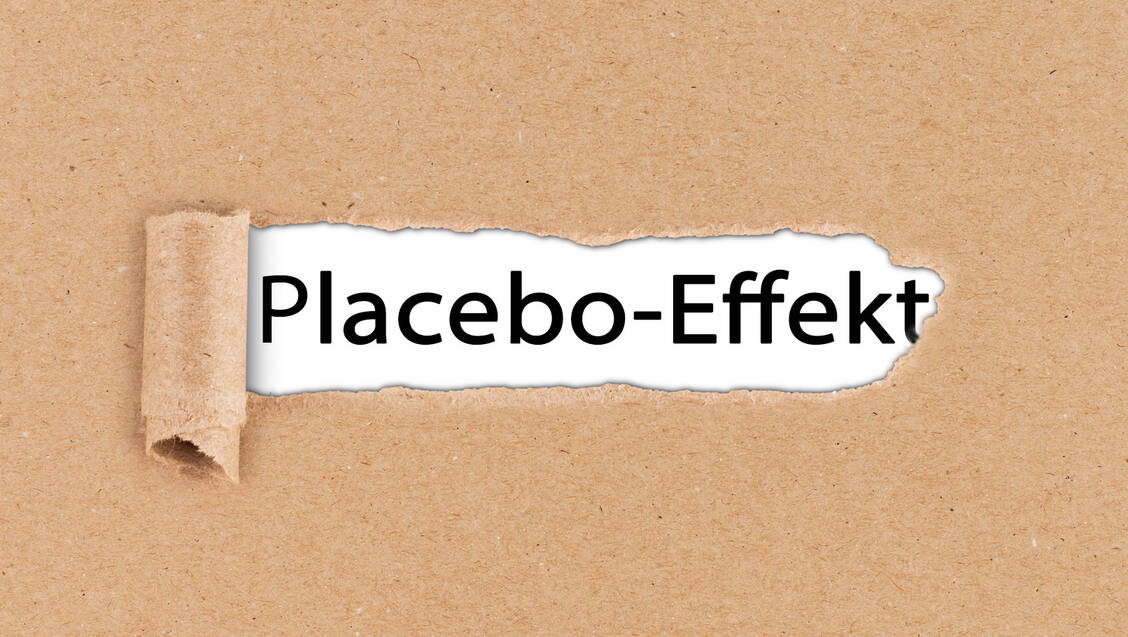Die Forscher stellten fest, dass neben der Symptomverbesserung außerdem 74 Proteine in der Placebo-Gruppe messbar verändert waren, darunter unter anderem einige Proteine, die mit einer Immunantwort bei akuter Übelkeit in Verbindung stehen. »Offenbar unterdrückt die Placebo-Behandlung diese schnelle Immun-Antwort«, wird Meißner in einer Pressemitteilung der LMU zitiert. Zudem gebe es Hinweise darauf, dass auch einige Neuropeptide, die für empathisches Verhalten und Bindungen bedeutend sind, mit dem Placebo-Effekt assoziiert seien. Diese können offenbar den Effekt verstärken. Erstaunlicherweise habe die untersuchte Proteinsignatur mit hoher Genauigkeit Auskunft darüber geben können, welcher Proband einen großen Placebo-Effekt entwickeln würde, berichtet Meißner.