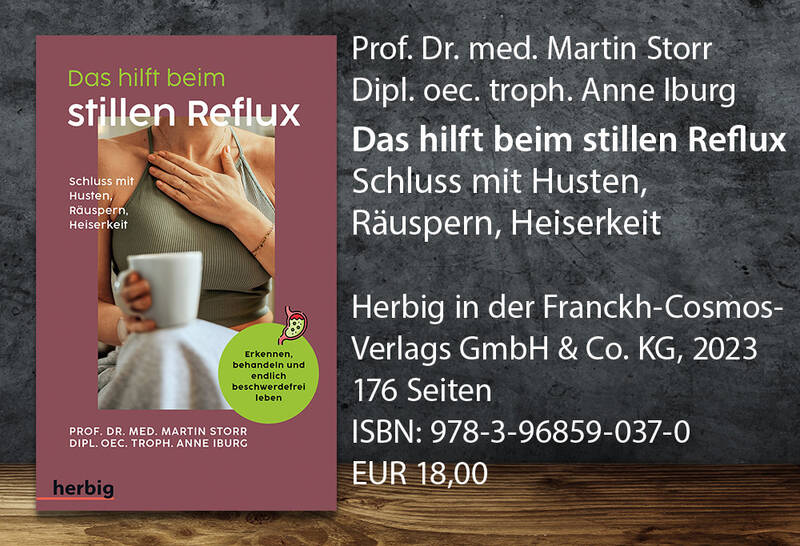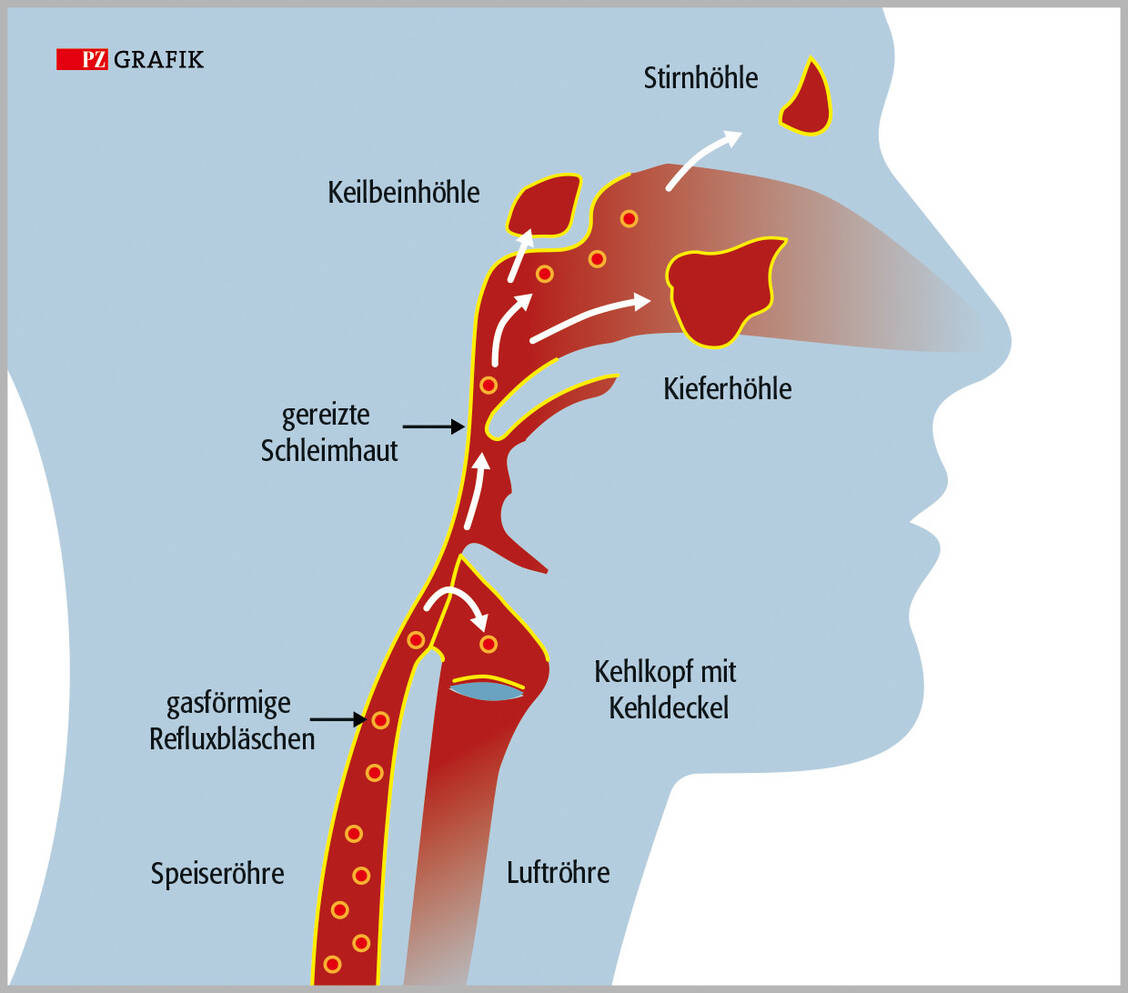Die Unterstützung der Schließmuskelabdichtung ist auch der Pluspunkt der Alginate. Sie greifen nämlich an der sogenannten Säuretasche (Acid Pocket), einer Ansammlung von Magensäure am Übergang vom Magen zur Speiseröhre, an. Alginate, die meist mit einem Antacidum kombiniert sind (wie Gaviscon® Dual, Reluba®), bilden einen Schaum auf der Acid Pocket und eliminieren diese. Zusätzlich bewirken sie eine mechanische Refluxblockade, ein auf dem Speisebrei schwimmendes Gel, das gleichzeitig wie ein Schutzfilm in der Speiseröhre wirkt. Auch Feigenkaktus-Extrakt (wie Refluthin®) oder ein Gel-Komplex bestehend aus Carbomer, Xanthan und Natriumhyaluronat (Sobrade®) wirken zur Speiseröhre hin abdichtend.
Dennoch: Es gibt Patienten, die trotz medikamentöser Säurehemmung Beschwerden haben. Der Grund ist einleuchtend: Die PPI unterdrücken zwar die Säureproduktion im Magen, verhindern aber nicht die, die dem Körper durch die Ernährung zugeführt wird. Um das Problem dauerhaft in Griff zu bekommen, kommt es deshalb vor allem auf die Ernährung an.