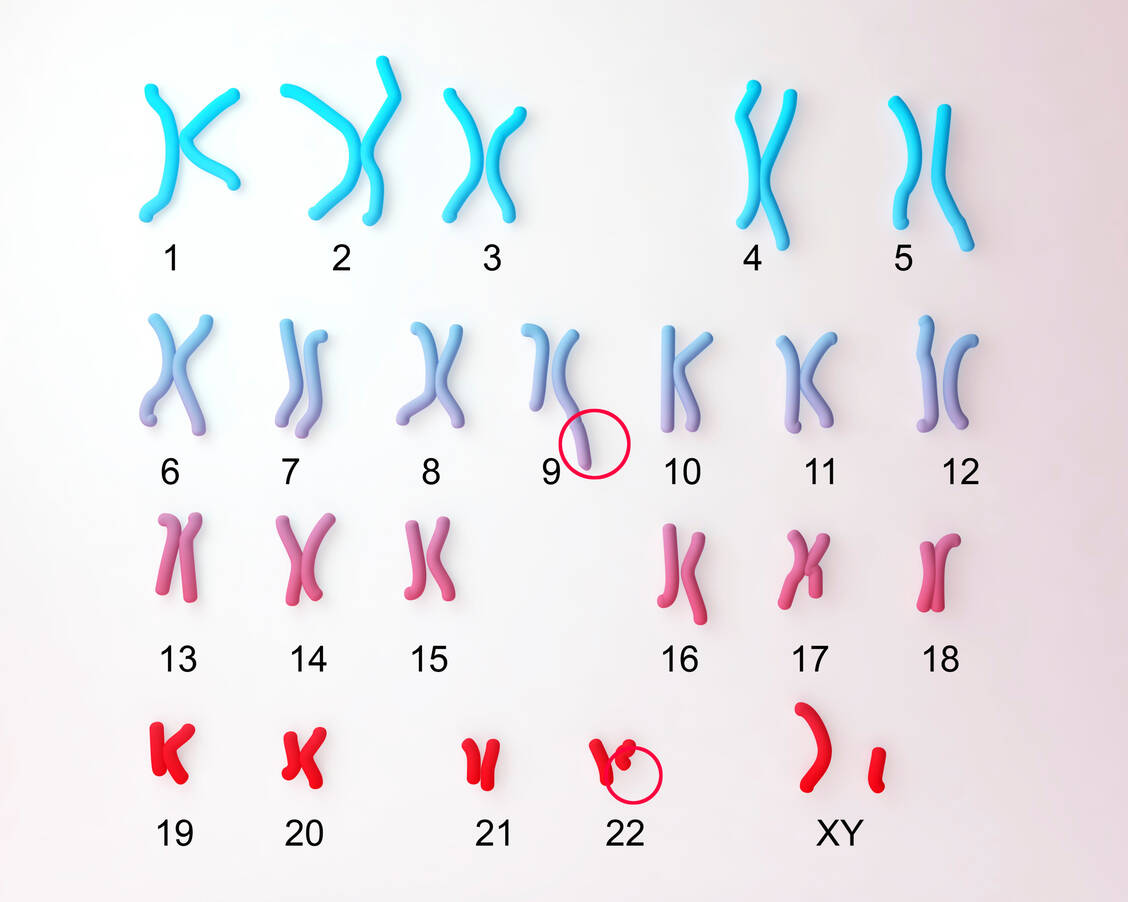Der Wirkstoff wird oral eingenommen. Empfohlen sind 40 mg zweimal täglich im Abstand von zwölf Stunden. Beim Auftreten von Nebenwirkungen wird die Dosis unter Umständen angepasst. Die Filmtabletten sollte der Patient außerhalb der Mahlzeiten einnehmen. Mindestens zwei Stunden vor und eine Stunde nach der Einnahme sollte er eine Nahrungsaufnahme vermeiden.
Sehr häufige Nebenwirkungen sind zum Beispiel muskuloskelettale Schmerzen, Infektionen der oberen Atemwege, Thrombozytopenie, Fatigue, Kopfschmerzen, Arthralgie, erhöhte Pankreasenzyme, Abdominalschmerz, Diarrhö und Übelkeit.
In der Fachinformation von Scemblix finden sich verschiedene Warnhinweise. Wegen einer möglichen Myelosuppression sollte der Arzt regelmäßig ein Blutbild machen lassen, wegen der Möglichkeit von toxischen Effekten auf die Bauchspeicheldrüse sollten deren Enzyme im Blick behalten werden und aufgrund eines potenziellen Anstiegs des Blutdrucks gilt es auch, diesen zu überwachen. Zudem kann es durch Asciminib zur Verlängerung der QT-Zeit am Herzen kommen. Auch dies sollte der Arzt bedenken und vorsichtig sein, wenn er den neuen Arzneistoff mit Substanzen kombiniert, die mit einem erhöhten Risiko für Torsade-de-pointes-Tachykardie einhergehen. Hinsichtlich möglicher Wechselwirkungen sind auch starke CYP3A4-Induktoren zu nennen, die zu einer reduzierten Wirksamkeit des Krebsmittels führen können.