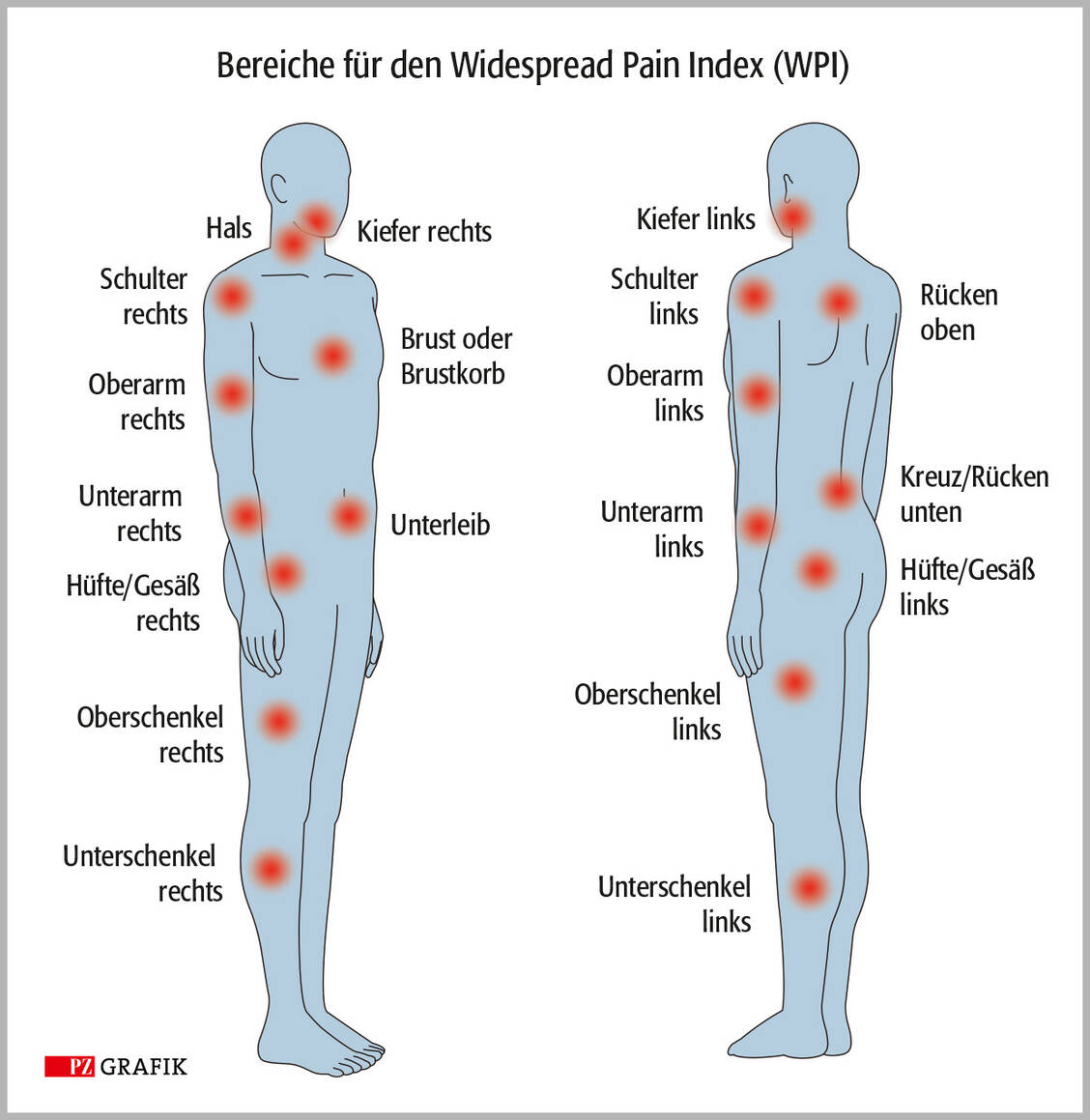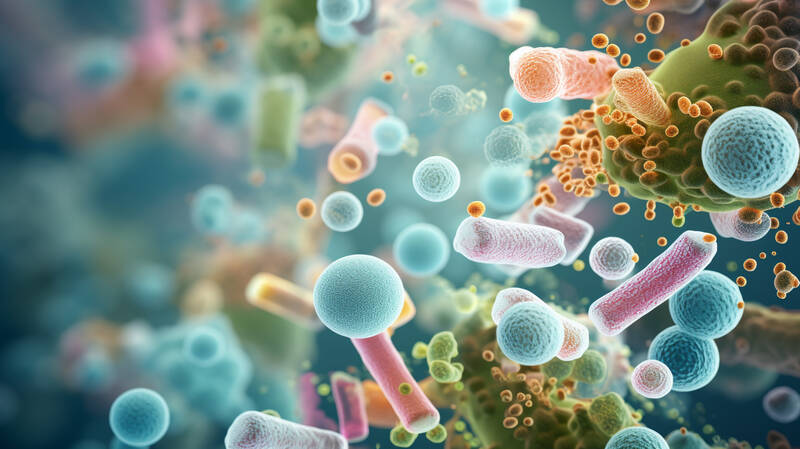Er beschrieb die zahlreichen Behandlungsansätze als kleine Stellschrauben eines Apparates, an denen sich gut drehen lasse. »Jede Maßnahme für sich hat zwar nur einen kleinen Effekt - so können wir etwa mit geeigneten Medikamenten rund 30 bis 40 Prozent Schmerzreduktion erzielen. Zusätzliche Aktivierung und andere Schmerz-Coping-Strategien, allen voran die Verhaltenstherapie, bringen dann noch mal ein paar Prozente, sodass wir in der Summe eine deutliche Besserung der Situation für den Betroffenen erreichen können und die Patienten besser mit ihrem Schmerz umgehen können.«
Welche Therapiebausteine sind für wen geeignet, welcher Patient profitiert am ehesten? »Es gilt, die Beschwerdelast für jeden einzelnen Patienten abzuschätzen, also zu eruieren, welches Symptom im Vordergrund steht«, weiß der Schmerzmediziner. »Das ist beim einen der nicht erholsame Schlaf, die Antriebslosigkeit, die Depression, bei der anderen die Schmerzen oder die vegetativen Begleitsymptome. Dies wird dann therapeutisch adressiert. Zusätzlich empfiehlt die DGS die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe.«