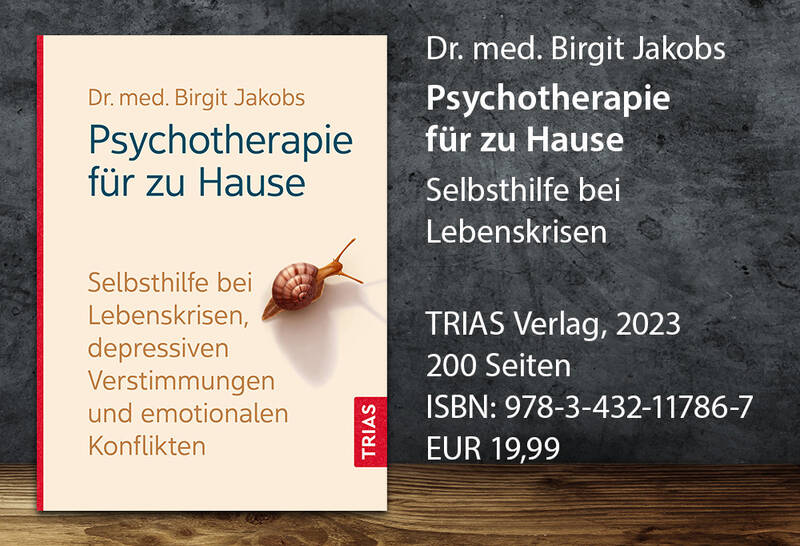Im Rahmen einer Psychotherapie wird oft ein seelisches Ungleichgewicht, eine psychische Störung, behandelt. Die Gründe für eine solche seelische Schieflage sind vielfältig: Trennung vom Partner, Tod eines geliebten Menschen, Konflikte auf der Arbeit, eine gefühlte Überforderung mit der Situation in der Familie oder in der Welt. Dabei gibt es psychische Störungen, die gemäß Jakobs eindeutig ein Therapeut behandeln sollte, etwa eine posttraumatische Belastungsstörung, Angststörungen (vor allem Panikattacken), schwere Depressionen, Persönlichkeitsstörungen, Somatisierungsstörungen (körperliche Beschwerden ohne Organbefund), Essstörungen und Zwangsstörungen.