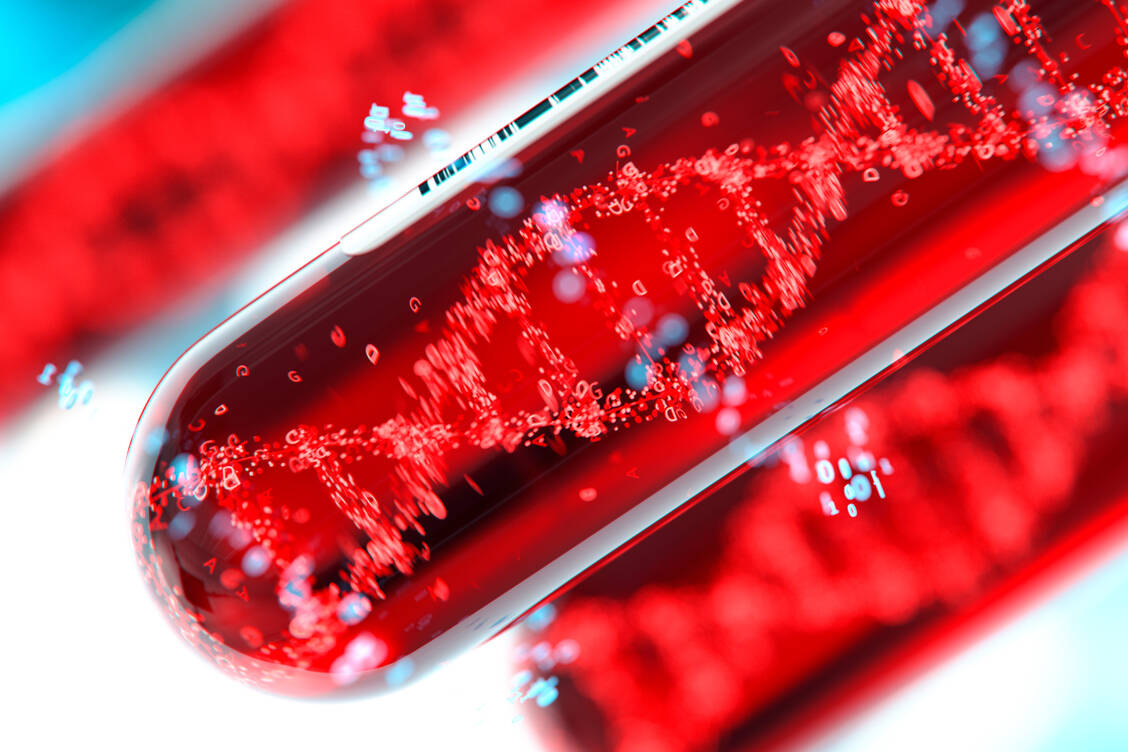Die Flüssigbiopsie kann auch für Therapieentscheidungen herangezogen werden. »Die ctDNA ermöglicht es, ohne einen invasiven Eingriff die Entwicklung von Tumoren zu verfolgen und Patienten zu identifizieren, die für eine bestimmte Therapie infrage kommen«, sagt der Experte. Tyrosinkinaseinhibitoren, die bei nicht kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) eingesetzt werden, wirken zum Beispiel nur bei bestimmten Mutationen am EGF-Rezeptor (EGFR) des Tumors. Weisen Ärzte diese Mutationen nach, setzen sie die Tyrosinkinasehemmer ein. Dieses Verfahren ist bereits in der Routine angekommen und wird in Kombination mit Biopsien angewendet.