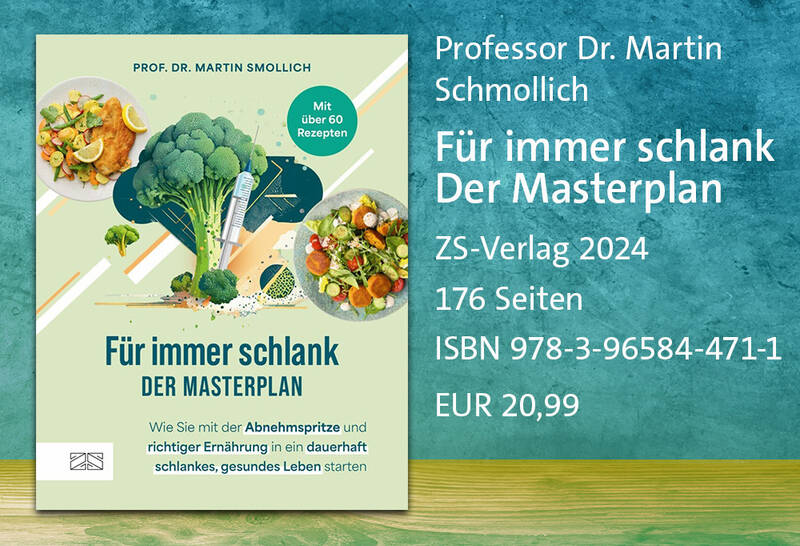Positive Effekte werden nicht nur bei Adipositas und Diabetes Typ 2 erzielt, sondern auch für gewichtsassoziierte Folgeerkrankungen wie Bluthochdruck, Fettsstoffwechselstörungen und Fettleber. Auch Verbesserungen der Nieren- und Herz-Kreislauf-Gesundheit sind beschrieben. Diese günstigen Auswirkungen erklären sich dadurch, dass GLP-1-Rezeptoren in vielen Organen zu finden sind: neben Darm, Bauchspeicheldrüse und Gehirn beispielweise auch in Herz, Gefäßen, Nieren und Immunzellen.
Unerwünschte Wirkungen sind oft durch die erwünschten Effekte bedingt: Starke Sättigung kann zu Übelkeit, Völlegefühl, Erbrechen oder Bauchschmerzen führen. Für schwere Nebenwirkungen wie Pankreatitis und ein erhöhtes Risiko von Schilddrüsentumoren konnten neuere Untersuchungen Entwarnung geben. Bislang ungeklärt ist eine mögliche Schädigung der Netzhaut, weswegen vor Beginn und im Behandlungsverlauf augenärztliche Kontrollen empfohlen sind.