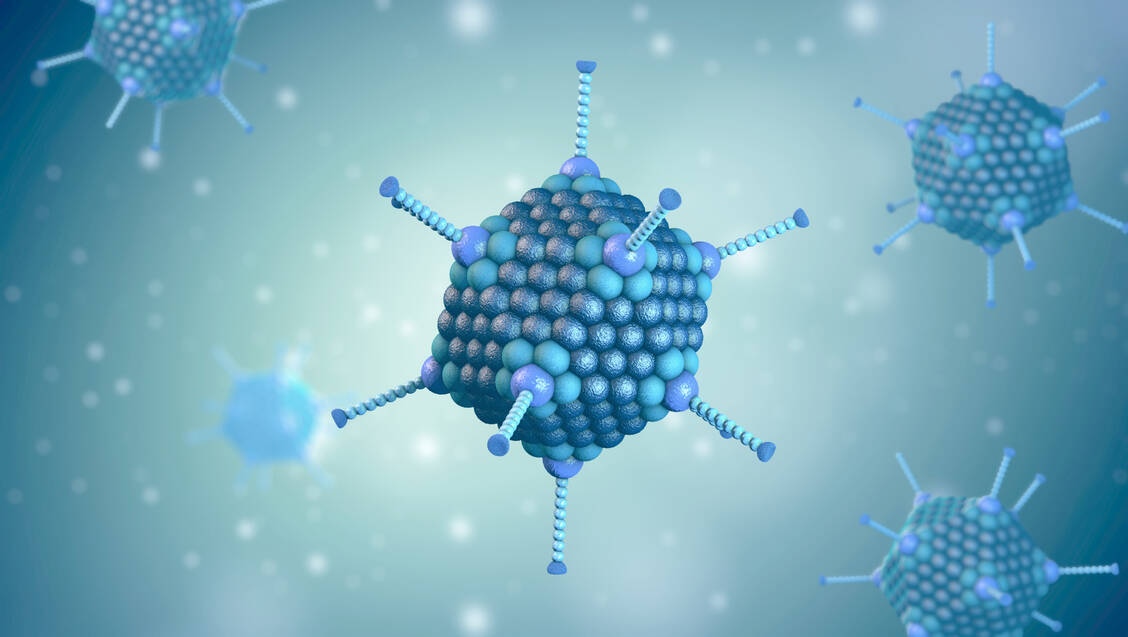Bisher konnten die Forscher nur für wenige virale Gene deren Funktion im Erbmaterial des Menschen erklären. So fanden sie den HI-Viren ähnliche Retroviren, die das humane Immunsystem partiell ausschalten können, und zwar genau dann, wenn eine Schwangerschaft eintritt. Das mütterliche Immunsystem toleriert vom ersten Moment an die embryonalen Zellen, die mit ihrem zur Hälfte vom Vater stammenden Erbgut ja eigentlich körperfremde Antigene sind. Vögel, Insekten und Reptilien legen aus genau diesem Grund Eier, Säugetiere müssen das dank der Anwesenheit von Viren nicht. Ihr Embryo kann sich bis zur Geburt im Schutz des mütterlichen Körpers entwickeln. Für den Aufbau der Plazenta sind ebenfalls Gene von Retroviren zuständig. Im Jahr 2000 entdeckten Wissenschaftler in Boston (USA) im menschlichen Genom die Gene des humanen endogenen Retrovirus Typ W, die ein Protein codieren, das die Fusion von Zellmembranen vermittelt. Sie fanden es an der Grenzschicht der Plazenta zum mütterlichen Uterus und nannten es Syncytin (»syn»... zusammen, »cyto»... Zelle). Diese auch Synzytiotrophoblast genannte Schicht besteht aus miteinander verschmolzenen Zellen und stellt die Barriere zwischen den Blutströmen von Mutter und Kind dar. Eine Trennwand, die dafür sorgt, dass zwischen Mutter und Kind keine Abstoßungsreaktionen stattfinden und in der zudem das Schwangerschaftsschutzhormon hCG (humanes Choriongonadotropin) gebildet wird.