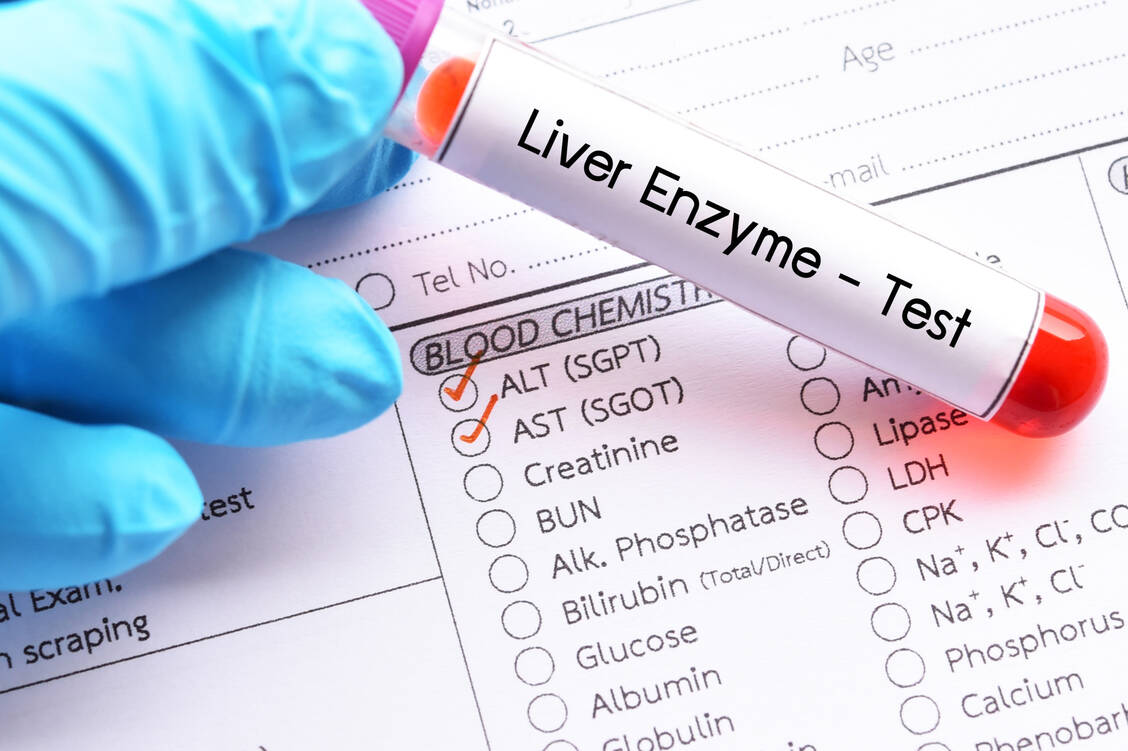Neben den Leberwerten entscheidet eine umfassende Anamnese über die Notwendigkeit weitergehender Untersuchungen. Viele Faktoren können die Leberfunktion beeinflussen und lassen sich im Gespräch identifizieren. Eine der wichtigsten Fragen ist die nach dem Medikamentengebrauch der Betroffenen. Zu den häufigsten Ursachen vorübergehend erhöhter Leberwerte gehört die Einnahme von Antibiotika, Antiepileptika, nichtsteroidale Antirheumatika, Statinen, Methyldopa und antiretroviralen Substanzen zur Behandlung von HIV. Allerdings sollten Betroffene auch pflanzliche Präparate und Nahrungsergänzungsmittel mit angeben, da sie ebenfalls Auswirkungen auf die Leber haben können. Weiterhin fragen Mediziner zum Beispiel nach dem Alkoholkonsum, der Exposition mit chemischen Substanzen, unternommenen Reisen, Tätowierungen oder der sexuellen Aktivität. Nicht zu unterschätzen ist zudem die Ernährung. Fällt sie sehr fettreich aus, kann das ebenso Auswirkungen haben wie eine Nahrungskarenz bei Fastenkuren.