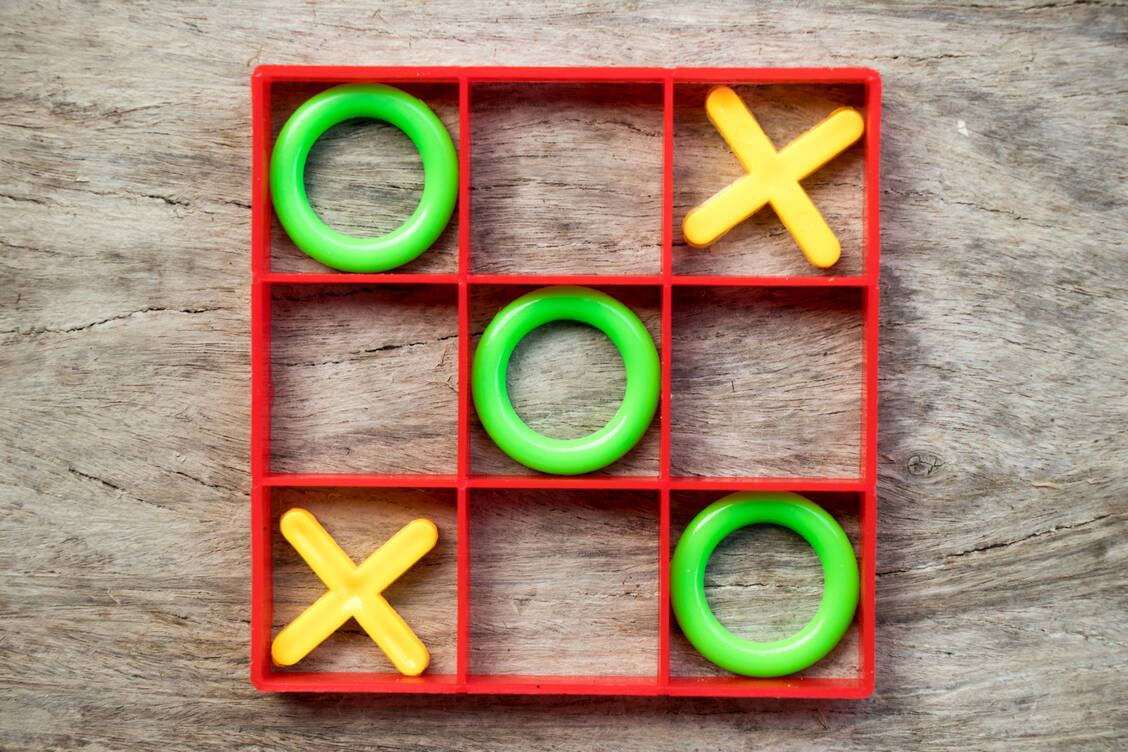Eine Ursache für die Beinachsenfehlstellung wird nur selten gefunden. Experten vermuten, dass genetische Faktoren eine tragende Rolle spielen, zudem können Leistungssportarten wie Fußball oder deutliches Übergewicht zu einer Verstärkung der Achsenabweichungen beitragen. Wesentlich seltener werden X- oder O-Beine durch Knochenbrüche, Tumoren oder Infektionen verursacht, die zu einer Schädigung der Wachstumsfuge geführt haben. In diesem Fall tritt die Beinachsenabweichung meist nur an einem Bein auf.
Über Jahrhunderte hinweg gehörte die Rachitis zu den häufigsten Auslösern von X- und O-Beinen. Heute kommt sie nur mehr bei wenigen Kindern vor und kann meist durch die Substitution von Calcium und Vitamin D3 erfolgreich behandelt werden.