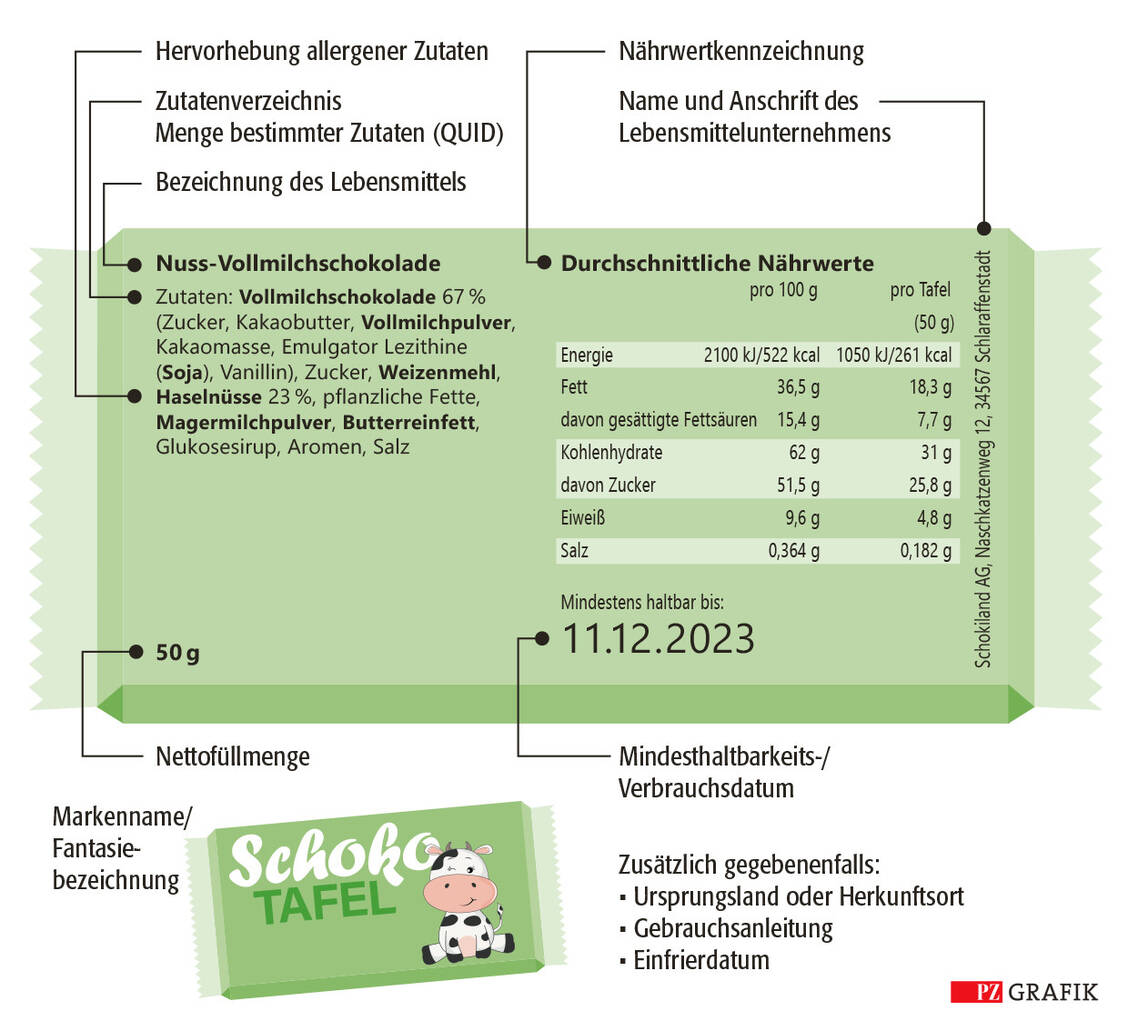Eine Herkunftsangabe ist nur für Obst, Gemüse, Olivenöl, Honig, Eier, Fisch sowie für frisches, gekühltes und gefrorenes Fleisch von Rind, Schwein, Ziege, Schaf und Geflügel gesetzlich vorgeschrieben. Für verarbeitete Lebensmittel entfällt diese Verpflichtung gänzlich. Oft stammen, wie inzwischen eine Vielzahl weiterer Lebensmittel, italienische Tomaten aus China. Nach der Ernte werden sie nach Italien verschifft und dort in Konserven mit der grün-weiß-roten Flagge gefüllt. Auch andere Zutaten einer Tiefkühlpizza sind oft weit gereist, bevor sie gemeinsam im Ofen landen: Schinken aus Frankreich, Pilze aus Holland, Mehl aus Polen, Käse aus Deutschland.